|
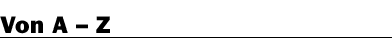
Diplomfeier
der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
Gratulation
zum Erreichten
Referat
von Ständerat Ernst Leuenberger, Solothurn, Freitag, den 05. Oktober
2007, Stadttheater Olten
Einige
Gedanken zu Sozialarbeit aus dem Munde eines Politikers und Gewerkschafters;
eines alt 68er gewiss auch, eines der sich aufgemacht hat auf den steinigen
Weg durch die Institutionen.
Ich war lange Jahre als Gewerkschaftsprofi aktiv. Wir haben gelegentlich
im Kollegenkreis gespottet, wir seien letztendlich bloss die Reparaturequipe
des Kapitalismus oder das Rote Kreuz einer Wirtschaftsordnung voller
Kälte, Rücksichtslosigkeit in einer Ellbogengesellschaft.
Mag sein, dass Sie Ihre Arbeit gelegentlich ganz ähnlich erleben:
Flicken, was der main stream an Geschädigten am Strassenrand liegen
lässt. Nachholen, was überforderte Elternhäuser und eine
hoffnungslos überlastete Schule nicht geschafft haben an Vermittlung
von Regeln und Einsichten für das soziale Zusammenleben.
Folgen jener menschlichen Grund-Entäuschung reparieren, die daraus
entsteht, dass eine trügerische Werbung an Schönheit, Reichtum,
Erfolg und Coolness versprochen und vorgegaukelt hat, was dann nie erreichbar
ist. Das landläufige Bild Ihres Einsatzes ist doch dieses: Die
Gesellschaft setzt Sie dort ein, wo etwas nicht funktioniert und verlässt
sich darauf, dass Sie die Mängel schnell und kostengünstig
und selbstverständlich nachhaltig beheben.
Dabei träumen
viele von Ihnen doch davon, gesellschaftsgestaltend zu wirken; beigezogen
zu werden zur Ausarbeitung von Konzepten, von grossen Würfen.
Es scheint mir aber, dass diese ganz anderswo gemacht werden. Ich weiss
nicht genau wo, ich war nämlich auch noch nie dabei.
Die Sozialarbeit
ist eine relativ junge Disziplin, der gesellschaftliche Aufbruch um
1968 und die ökonomische Umgestaltung hat sie gross gemacht. Ironischerweise
erinnere ich mich an 1968 als eine Zeit, wo man Sozialarbeit vor allem
von Links kritisiert hat. "Hilf dir selbst, sonst hilft dir ein
Sozi…" hat es in der antiautoritären Bewegung geheissen.
Selbsthilfe, Autonomie, Antipsychiatrie hiessen die Schlagworte; auch
eine fundamentale Kritik der Volksschule ging damit einher. Die Wege
der Wortführer sind unterschiedlich verlaufen; nicht wenige arbeiteten
dann im Sozialbereich. Man hat eben gelernt, mit Widersprüchen
und Dialektik umzugehen.
Im Zuge
der Jungendunruhen von 1980 akzentuierten sich diese kritischen Tendenzen
noch; man wollte nicht ein Jugendzentrum mit Sozial- und Jugendarbeitern,
man forderte ein AJZ - und zwar subito. Mittel- und längerfristig
wurden viele Freiheiten möglich, nicht zuletzt wirtschaftliche
Freiheiten. Doch als 1980, 81 die Träume der Jugendlichen sich
zerschlugen - zerschlagen wurden - machten bei vielen die Heroinspritzen
die Runde. Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs: Wir, die Politiker und
Staatsbürger in den 80er Jahren, mussten uns nicht zuletzt mit
der Drogenfrage auseinandersetzen. Lange, für die Betroffenen sehr
schmerzhafte Prozesse, führten schliesslich zum sogenannten Drogenkompromiss.
Abgabe von sauberen Spritzen, Verschreibung von Heroin an Schwerstabhängige.
Eine Politik, mit der die meisten relativ gut leben können. Die
Junkies stören nicht nur weniger, es geht den meisten wirklich
besser. Die Unterstützung "auf der Gasse" haben Sozialarbeiter
geleistet, selten waren diese im Zentrum der Aufmerksamkeit. Um so wichtiger
war und ist ihre Arbeit.
Noch einmal
zurück zur letzten Jugendbewegung. Wie haben sich doch die Zeiten
geändert. Niemand sprayt mehr die Parole "Macht aus dem Staat
Gurkensalat!" an die Wand. Die Staatsabschaffer im neuen Jahrtausend
haben andere Medien zur Verfügung. Nennen wir heute in dieser Feierstunde
keine Parteinamen; Sie wissen, wer den Nachtwächterstaat will und
von der "Sozialhilfeindustrie" spricht und tut als ob Sozialhilfemissbrauch
die Norm und nicht die Ausnahme wäre.
Ich spreche zu Ihnen als Politiker. Sie verfolgen die aktuelle Politik,
Sie wissen, wo die grossen Auseinandersetzungen stattfinden, die auch
Ihre "Branche" angehen, auch wenn man während des Wahlkampfes
oft den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
sieht.
Wenn heute
vom Sozialstaat die Rede ist, fehlt nie der erhobene Zeigefinger, der
auf den Missbrauch deutet. Gewiss: Missbrauch ist ärgerlich, verwerflich;
muss vermieden werden; gehört geahndet, bestraft, abgestellt. Darüber
braucht man gar nicht lange zu diskutieren. Und diese Aussage gilt generell
nicht nur für Empfänger/innen von Sozialleistungen.
Diese Sozialmissbrauchs-Diskussion
lässt sich allerdings leicht in die politische Grosswetterlage
einordnen:
Laute politische Wortführer betreiben ein übles Spiel: Sie
nehmen aufgedeckte Missbrauchsfälle zum Anlass, das ganze System
der Sozialhilfe, ja der Sozialversicherung zu diskreditieren. Schliesslich
hat ja ihre Kampagne gegen die Scheininvaliden bereits Wirkung gezeigt.
Sie werden dabei unterstützt von eilfertigen Medienschaffenden,
die immer der Kuh mit den grössten Hörnern nachlaufen ohne
sich zu fragen, wessen politisches Geschäft sie eigentlich betreiben.
Die Perfidie dieses neuen Angriffs auf den Sozialstaat besteht darin,
dass ein wirrer und teuflischer Mix aus populärer Ausländerfeindlichkeit
und Sozialneid und dem Vorwurf des Sozialmissbrauchs zusammengeschustert
wird.
Also sind
wir bei der Missbrauchsbekämpfung. Jedes Sozialamt, jede Sozialversicherung
muss personell so ausgestattet sein, dass die Gesuchsprüfung so
gründlich erfolgt, dass Missbrauch sehr, sehr schwierig wird. Kontrollen
müssen auch sein. Dass man deswegen gleich den Datenschutz für
Sozialhilfe-Empfänger/innen eliminieren muss, überschiesst
gewaltig. Vorbei sind die Zeiten, wo die Gemeindefürsorgekommissionen
nach Sitzungsschluss noch im "Bären" hockten und die
Fälle noch einmal Revue passieren liessen. Vorbei sein müssen
die Zeiten als Arme lieber Hunger litten als sich bei der Sozialfürsorge
zu melden. Vorbei sein sollen die Zeiten, wo man Arme an den Pranger
stellte als mahnendes Beispiel für die sogenannt Braven.
Die Folgen
der 5. Revision der Invalidenversicherung sind noch kaum präzise
zu beschreiben. Der Schwerpunkt, der auf Eingliederung und Selbsthilfe
gelegt wird, weckt bei mir alte 68er Reflexe und damit durchaus gemischte
Gefühle. Die Selbsthilfe hat dort Grenzen, wo es um psychische
Behinderungen geht. Da müssen geschützte Arbeitsplätze
her - aber gerade Staatsbetriebe schaffen diese wegen des Kostendrucks
ab. Und: Die Verkürzung der sozialpolitischen Diskussion auf die
Missbrauchsbekämpfung ist kein brauchbarer Ansatz für eine
gute Politik des sozialen Ausgleichs. Sozialer Ausgleich war, ist und
bleibt ein Wesenselement der Eidgenossenschaft. Die öffentlichen
Hände: Bund, Kantone und Gemeinden müssen die nötigen
Mittel dazu zur Verfügung stellen und er daher auch die Einnahmen
generieren können. Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen ist
im Endeffekt ruinös.
Ein funktionierender
"Service public", ein nicht-diskriminierendes Gesundheitssystem,
eine Schule, welche nicht die Chancengleichheit untergräbt, Tagesschulen
und mannigfaltige Sozialarbeit: das alles kostet Geld.
Patentrezepte gegen den Anstieg der Sozialausgaben wie eine Rückbesinnung
auf die Familie oder Verwandtenhilfe greifen zu kurz. Viele nutzen diese
Möglichkeiten, müssen diese Möglichkeiten auch nutzen.
Ganz vielen aber reicht das nicht.
Gerade Gewaltprävention geht nicht nur die Familien an; zu oft
ist gerade die Familie kein gewaltfreier Raum. Professionelle Sozialarbeit
an Schulen ist nötig. Nötig ist auch Mitbestimmung der Schülerinnen
und Schüler. Notwendig aber sind vor allem Zukunftsperspektiven.
Lehrstellen, Ausbildungsplätze, Weiterbildungsmöglichkeiten.
Lehrstellen lassen sich zwar nicht staatlich verordnen, aber fördern
lassen sie sich schon. Während Wachstumsphasen der Wirtschaft sind
zukunftsweisende Projekte möglich in der Umwelt- in der Arbeits-
in der Sozialpolitik. Ob sich die Gewichte im Parlament in diese Richtung
verschieben werden, sehen wir nach dem 21. dieses Monats.
Wir sind
hier in Olten, ziemlich in der Mitte des goldenen Dreiecks Zürich-Basel-Bern
und die Realität war wohl nie so zugespitzt, wie ich sie eingangs
umrissen habe. Bei uns ticken manchmal die Uhren anders. Ich weiss noch
gut, wie kleine und mittelgrosse Solothurner Gemeinden um Jugendarbeiter-
und -häuser gekämpft haben und immer noch kämpfen müssen.
Quartierspielplätze müssen betreut und unterhalten werden;
Institutionen wie das "Alte Spital" in Solothurn, die soviel
für die Integration Jugendlicher leisten, sind keine Selbstverständlichkeit.
Diejenigen, die im Sozialbereich arbeiten, wissen das. Kaum einer oder
eine im Sozialbereich Tätige spult einen 08/15 Job ab. Da ist viel
Herzblut bei der Sache, viel Engagement. Sie, die Ihre Ausbildung jetzt
mit Erfolg abgeschlossen haben, haben gerade darum diesen Weg gewählt.
Behaupte ich jetzt einfach einmal.
Sie sehen, ich bin im Wahlkampf: die Katze kann das Mausen nicht lassen.
Dazu fällt mir immer der Satz von Herbert Wehner ein, der im Deutschen
Bundestag nach einer wortgewaltigen Philippika ausgerufen haben soll:
"Verzeihen Sie mir meine Leidenschaft; ich würde Ihnen Ihre
auch gerne verzeihen."
Ich bin ganz sicher, dass ich vielen von Ihnen viel Leidenschaft verzeihen
könnte, dürfte, müsste, würden wir uns irgendwo
irgendwann über den Weg laufen und in Diskussionen eintreten. Ich
denke, Ihre Leidenschaft ist auch ein grosser Brocken Menschenliebe.
Ich habe als Nationalratspräsident 1998 bei der Verabschiedung
von Bundesrat Delamuraz gesagt: Ein guter Bundesrat muss die Menschen
gern haben.
Ich bin inzwischen zur Einsicht gelangt, dass dieser Satz auch für
gute Sozialarbeiter/innen gilt.
Und noch eines: damals 1968 haben wir in Momenten tiefer Verzweiflung
über das Geschehen immer ausgerufen: Wir sind historische Optimisten.
Wir glauben nämlich daran, dass die Welt erschaffen wurde, um zu
blühen und zu gedeihen und nicht um in Nacht und Chaos zu versinken.
Ihnen,
den erfolgreichen Absolvierenden der Hochschule für Soziale Arbeit
FHNW wünsche ich spannende Jobs, viel Arbeit und noch mehr Befriedigung
bei Ihrem Tun.
|
|
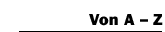 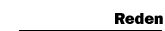  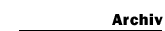 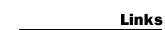 |