|
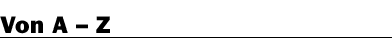
700
Jahre Aedermannsdorf
Ansprache
von Ständerat Ernst Leuenberger, Solothurn. Sonntag, 31. August
2008 in Aedermannsdorf
1. Einleitung
Ich danke
für die Ehre, an diesem feierlichen und besinnlichen Anlass sprechen
zu dürfen.
Der Anlass "700 Jahre Aedermannsdorf" ist nicht bloss eine
heitere Geburtstagsfeier, auch nicht nur ein fröhliches Dorffest.
Es ist mehr: ein besinnlicher Gedenkanlass mit Frohmut und Freude gefeiert.
Dazu gehören:
Viel
Freude am Erreichten,
Der Willen,
kommende Probleme zu meistern;
Etwas
über den Gartenzaun zu schauen, nämlich visionär zu
sehen versuchen, was auch noch sein könnte.
Menschliche
Sehnsüchte nach Utopia; nach kindlich-zauberhafte Märchenwelten
gehören auch zum Jubiläum.
Ich bin
beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welchem Einsatz Ihr OK
diesen Anlass vorbereitet hat.
2. Chronik
Allein
die Chronik, verfasst durch den Historiker Dr. Albert Vogt wäre
ein ganze Würdigungs-Rede wert. Sie ist eine wahre Fundgrube für
Intressierte. Sie gibt uns beides: Information und Anstoss zum Nachdenken
über das Woher und Wohin.
Wir wissen es: Aus der Geschichte nichts lernen wollen, ist falsch ,
kurzsichtig und überheblich.
Aber aus der Geschichte lernen ist schwierig. Während die einen
sagen, wir wollen es genau so machen wie damals; sagen die andere, es
sei wichtig, genau das Gegenteil von damals zu machen. Vielleicht seufze
ich bei solchen Diskussionen jeweils, seien doch auch politische und
gesellschaftliche Auseinandersetzung bloss die Suche von Mass und Mitte…
Die Chronik zeigt auch Veränderungen auf. Wir werden Zeugen von
radikalem Bedeutungswandel, z.T. Bedeutungsverlust.
Was über Jahrhunderte Aedermannsdorf prägte, hat sich verändert:
Die Landwirtschaft
ist ein sehr kleiner Wirtschaftszweig geworden
Und auch
die Industrie ist teilweise sogar verschwunden (von Roll Klus, Keramikindustrie).
Der Kulturkampf
gehört glücklicherweise der Vergangenheit an.
Religion
und Kirche haben an Einfluss auf das Leben der Menschen verloren
3. Das
Festspiel
Festspiel
"Zmitts inne im Jura" von Bruno Born, die geraffte szenische
Darstellung dieser 700 Jahre, ungeschminkt die Fakten. Der Versuch ist
gelungen, Geschichte darzustellen und zwar nicht als Klamauk, auch nicht
als gute alte Zeit, sondern auch als Lehrstück wie es damals war,
wohl auch verbunden mit dem Gedanken, manches sei glücklicherweise
besser geworden.
Die auf der Schattseite standen; ich meine etwa Arme, Ausgegrenzte,
Verdingkinder, Heimatlose erfahren durch die Darstellung ihres Schicksals
ein Stück Gerechtigkeit.
Für sie gilt ganz besonders: " den Alten zur Ehr, den Jungen
zur Lehr."
Solch eindrückliche Darstellung ruft nach einem kleinen Marschhalt,
um über die Frage zu sinnieren: woher kommen wir, wo stehen wir
heute, wohin wollen wir gehen?
4. Heimat
Zmitts
inne im Jura
"Wenn Du im Thal aufgewachsen bist, so lässt dich diese Gegend
dein ganzes Leben nicht mehr los" Dieses Kompliment an das Thal
lasen wir 1981 bei Wolfgang Hafner, aus Balsthal.
2005 publiziert er in "Dort oben die Freiheit" eine kritische
Liebeserklärung an den Solothurner Jura und macht gleichzeitig
aus der Solothurner Juraschutzzone von 1942 einen Leuchtturm an weiser
Voraussicht in Sachen Umweltschonung.
Es gelte,
dem Berg seine Eigenheit zu lassen und nicht alles zu überbauen.
Oder
eben " die Freiheit oben auf den Bergen, weit weg vom Stress"
zu bewahren.
"Die
Solothurner/innen waren und sind hoffentlich auch in Zukunft bereit,
ihren Beitrag zur Erhaltung der Freiheit auf dem Berg zu leisten."
5. Heimat Gemeinschaft Fernweh und Ausgrenzung
Alle Liebeserklärungen
an die Heimat werfen die Frage auf, was denn eigentlich Heimat und Gemeinschaft
ausmachen. Es ist sicher die Vertrautheit mit den Verhältnissen
und den Menschen, es ist sicher die Gewissheit dass die Gemeinschaft
auch eine Solidargemeinschaft sein will; es ist die Gewissheit, das
keiner verloren gehen kann.
Gemeinschaft entsteht nicht aus dem Nichts. Täglich ist daran zu
arbeiten. Und Solidargemeinschaft heisst denn auch Teilen. Und bekanntlich
gehört Teilen zum Schwierigen im menschlichen Leben. Gemeinschaft
gibt ein Wir-Gefühl, schafft Identität.
Und wir haben es in Schillers Tell gelesen: " Verbunden werden
auch die Schwachen mächtig."
Das Wir-Gefühl kann aber auch zu Ausgrenzung führen. "Du
bist ein Fremder; Du gehörst nicht zu uns; mit Dir wollen wir nicht
teilen."
Wir haben zwar alle den wunderbaren Text von Matthias Claudius im Ohr
und singen ihn mit Inbrunst und sind einverstanden damit: "Verschon
uns Gott mit Strafen und lass und ruhig schlafen und unseren Kranken
Nachbarn auch."
Allerdings
sagen wir damit nichts darüber aus, was wir tun, wenn uns dieser
Nachbar nicht sympathisch ist, ja wenn er uns stört und auf den
Wecker geht.
Da ist dann die Solidargemeinschaft auf die Probe gestellt und es wir
schwierig. Und wir haben tätig zu werden ob aus "Solidarität"
oder aus Caritas nach dem Motto "Einer trage des andern Last"
ist dann nicht mehr so wichtig.
Mir ist
wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass das Leitmotiv
der Egoisten keine Gemeinschaft begründet, unsolidarisch ist und
bleibt.
Dieses Leitmotiv heisst etwa:
"Wenn jeder für sich schaut, ist für alle geschaut."
Zu den
schwierigen Fremden fällt mir immer wieder ein, dass alle Menschen
Phasen von Fernweh, Reise- und Abenteuerlust erleben. Phasen mit dem
Wunsch auszubrechen aus unseren kleinen Welt, in die wir dann so gerne
wieder zurück kehren.
Wenn wir schon zu Gast sein wollen in allen Erdteilen, in allen Ländern,
dürfen wir manchmal auch etwas gastfreundlicher sein zu Menschen,
die als Flüchtige, als Vertriebene oder auch als Arbeitende zu
uns kommen.
6. Wandel
Eine Jubiläumsfeier
könnte den Irrtum hervorrufen, die Menschen meinten nun, es bleibe
alles wie es jetzt gerade sei. Oder das Ende der Geschichte sei gekommen.
Der Wandel, die Entwicklung geht weiter, schreitet unaufhaltsam voran.
Ich meine technischen Wandel, wissenschaftlichen Wandel; wirtschaftlichen
Wandel, gesellschaftlichen Wandel.
Ich komme konkret zurück zu dieser Region: im Jahr 2000 fand im
Kunstmuseum Solothurn die Fotoausstellung "Leute im Thal Sommer
1940" statt. Albert Vogt hat damals Fotos seines Vaters Georg Vogt
gezeigt. Diese Bilder von 1940 zeigen deutlich den Wandel in den verflossenen
Jahrzehnten. Die Menschen, ihre Kleidung, die Hintergründe, die
teilweise scheuen Blicke in die Kamera zeugen von einer versunkenen
Zeit und lassen einiges ahnen, was im Mai/ Juni 1940 die Menschen hier
bedrückt hat; der um die Schweiz herum tobende 2. Weltkrieg und
die Ungewissheit, ob die Schweiz verschont bleiben wird.
Wandel ist unausweichlich und unvermeidbar. Das einzig Beständige
ist der Wandel. Wir haben dafür zu sorgen, dass dieser Wandel die
menschlichen Grundwerte und die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt.
|