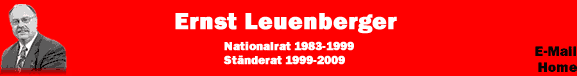
|
||
|
Solothurnisch
sein oder SO sind wir. Pioniere der Freiheit Wer immer Solothurn sagt, meint auch Grenchen und Olten, zählt dazu Balsthal, Dornach, Schönenwerd, Rodersdorf und Kleinlützel, dann Messen und die Wöschnau. Wer also Solothurn sagt, umschreibt damit ein Territorium von der französischen Grenze, an den Toren der Stadt Basel vorbei bis fast nach Aarau, dann bis nahe an Bern und Biel heran und selbstverständlich die in diesem Gebiet lebenden und wirkenden Menschen. Damit sind die Grenzen dieses alten Kantonalstaates dargestellt. Seinen bemerkenswerten Grenzverlauf hat der frühere liberale Stadtammann von Olten, Hans Derendinger (1920-96), so beschrieben: «Viel Hag und wenig Garten …» Letztlich hat sich dieser Kanton ja zwischen der alt-eidgenössischen Grossmacht Bern im Süden und dem mächtigen Basel im Norden behaupten müssen. In der heutigen fremdenfeindlichen Zeit, wo eine ganze Bundesratspartei schwergewichtig auf Fremdenfeindlichkeit macht und damit gross wird, liegt mir viel daran, zu beschreiben, wie man solothurnisch (kämpferisch für Toleranz und Offenheit) wird. Vielleicht, das sei warnend vorangestellt, sind meine Äusserungen über Solothurn geprägt von Konvertiten-Eifer, bin ich doch ein Einwanderer in Solothurn, im Kanton Solothurn. Immerhin hat mich die Solothurner Regierung am 3. Dezember 1997 als neugewählten Nationalratspräsidenten auf der St. Ursentreppe zu Solothurn mit den Worten empfangen: «Er ist ein Solothurner». Das war Balsam auf eine Seele, die sich zwanzig Jahre vorher hatte beschimpfen lassen müssen «Leuenberger zeichnet sich durch unsolothurnisches Verhalten aus». Mein Text könnte leicht eine Liebeserklärung werden frei nach dem Grenchner-Lied: «und wenn der Himmel papierig wär und jede Schtärn e Schryber wär, und schrybti mit siebe Händ, er schrybti mir Liebi kes Änd.» Ich lebe und wohne seit über 30 Jahren hier. Ich fühle mich wohl und gehöre dazu. Manchmal gehöre ich wieder nicht mehr dazu, etwa wenn Solothurn vergisst, sich auf seine liberal-radikal-sozialen Wurzeln und Werte zu besinnen. Werte die da sind: kämpferisch für Toleranz und Offenheit, die ihren Ausdruck im Solothurner Lied finden: «… Heide, Chrischte, Katholike, alles isch derbii» oder auch in der Devise «me söll ufenand lose, nit ufenander los». Toleranz, Ausgleich und Offenheit, und kämpferisches Einstehen dafür, gelten als solothurnische Tugenden. Dabei wird oft Schultheiss Niklaus Wengi zitiert, der sich 1533 in den Reformationswirren in Solothurn vor die Kanone gestellt haben soll, als Katholiken auf die Protestanten in der Vorstadt schiessen wollten. Im übrigen ist Solothurn der einzige mehrheitlich katholische Kanton, dessen Volk sich seit dem frühen 19. Jahrhundert stets freisinnig (durchaus im liberal-radikalen Sinn) regieren liess. Liberalismus à la Soleuroise verband sich mindestens in der Vergangenheit stets mit dem grossen sozialen Versprechen des jungliberalen Regierungs- und Nationalrats Urs Dietschi (1901-82), freisinnige Sozialpolitik sei Politik « des warmen Herzens und der offenen Hand». So war es denn auch der freisinnige Bundesrat Walther Stampfli (1884-1965), ein Wirtschaftsvertreter durch und durch, der zusammen etwa mit meinem Ur-Vorgänger als Eisenbahner-Chef Robert Bratschi (1891-1981) dem grössten Sozialwerk der Schweiz, der AHV, 1947 zum Durchbruch verholfen hat. Es wäre ein Leichtes, jetzt Unterschiede zwischen damals und heute aufzuzeigen. Ich will das so wenig als möglich tun und halte mich vielmehr an das Wort: « den Alten zur Ehr, den Jungen zur Lehr» und preise solothurnische Offenheit. Nehmen wir Solothurn beim Wort: kämpferisch für Toleranz, Offenheit und Ausgleich: Ausgrenzen ist nicht solothurnisch. Ich nenne historische Zeugnisse dafür. - Als im Schwabenkrieg 1499 nach der Schlacht von Dornach die Kriegsopfer (Freund und Feind) zu beerdigen waren, hiess die Solothurner Devise: «Die Edlen müssen bei den Bauern liegen.» - Die solothurnische Stadt Grenchen feiert 2005 den 200. Geburtstag des italienischen Freiheitskämpfers Giuseppe Mazzini (1805 Genua bis 1872 Pisa). Warum das? Und warum eigentlich ist jeder Stadtpräsident von Grenchen von Amtes wegen auch Ehrenbürger von Genua? Das kam so: Der nationalen Einigung Italiens im 19. Jahrhundert stand vor allem die österreichische Besatzungsmacht unter Metternich im Wege. Als Freiheitskämpfer musste auch Mazzini flüchten. Sein Weg führte ihn 1834 über viele Stationen zu Dr. Josef Girard (1803-1869) nach Grenchen. Sofort war Mazzini an der Gründung der Jungen Schweiz/jeune Suisse beteiligt, in welcher sich die jungen kämpferischen Anhänger eines schweizerischen Bundesstaates zusammenfanden. 1836 verlangt der Bürgermeister von Zürich die Verhaftung Mazzinis und seiner Freunde in Grenchen, weil diese einen Freischarenzug nach dem Grossherzogtum Baden in Deutschland aushecken würden. Die Solothurner Kantonsregierung verlangte die Ausweisung Mazzinis, worauf die Bürger von Grenchen ihm das Grenchner Bürgerrecht erteilen. Die Solothurner Kantonsregierung hebt allerdings den Einbürgerungsbeschluss wieder auf. Der Vorort (damals Regierung der Eidgenossenschaft) setzt eine Kopfprämie auf Mazzini aus. Die Tagsatzung verfügt die Ausweisung, so dass Mazzini am 2. Januar 1837 Grenchen verlassen muss. Ammann, Gemeinderäte, Dr. Girard mit Anhang und der Weibel mit der Grenchner Fahne begleiten die zwei Kutschen bis an die Kantonsgrenze. Mazzini findet nun in England Asyl. Grenchen muss sich geschlagen geben. Der Grenchner Chronist schreibt in der Gedenkschrift 2005: «Grenchen war zu einem Ärgernis der europäischen Grossmächte geworden, die mit massiven Drohungen Druck aufsetzten, damit einem international gesuchten Revolutionär endlich die Tätigkeit verunmöglicht würde.» Der Chronist frägt dann:» wer war Mazzini? Heiliger oder Teufel, Befreier oder Terrorist, der umstrittene Che Guevara des 19. Jahrhunderts?» Immerhin Mazzini hat etwas bewirkt: Italien wird 1870 geeinigt, die Junge Schweiz errichtet den Schweizerischen Bundesstaat 1848. Grenchen behielt einen bestimmten Ruf seit jenen Tagen. «Grenchen sei ein europäischer Name geworden» soll der Solothurner Regierungsrat Joseph Munzinger (1805-55), später Bundesrat, gesagt haben. Und in der Tat: Beim Generalstreik von 1918 war das Militäraufgebot in der Uhrenstadt Grenchen so massiv, dass bei einem unrühmlichen Einsatz drei erschossene Grenchner zu beklagen waren. Derer wurde zwar mit einem Erinnerungsstein gedacht, der allerdings später spurlos verschwunden, vermutlich versenkt oder verlocht worden ist. Der Streikführer Max Rüdt (1888-1947) wurde aus dem Kanton Solothurn verjagt. Und dennoch: auch der Generalstreik ist nicht ohne Wirkung geblieben. Der Aufbau des Sozialstaates Schweiz hat durch dieses einschneidende historische Ereignis starken Auftrieb erhalten. - Und noch einmal ein italienischer Flüchtling: Nach Polizeiberichten tagte 1927 das Zentralkomitee der exilierten italienischen Kommunistischen Partei unter Palmiro Togliatti 1893-64) – vom Mussolini-Regime verfolgt, nach dem 2. Weltkrieg italienischer Minister – im Naturfreundehaus auf dem Passwang. Eine Polizeiaktion löste die Tagung auf. Togliatti konnte unter dem Namen «Bianchi» unerkannt entkommen. Dies entnehme ich der Beschreibung von Wolfgang Hafner, 1949, in Balsthal geboren, in seinem Gesang auf den Solothurner Jura: «Dort oben die Freiheit». Erwiesen ist, dass Solothurner die Exilierten unterstützten, etwa der nachmalige Bau- und Holz-Gewerkschaftssekretär Angelo Moretti (1910-1985). - Ein Kapitel für sich ist der Kampf der Solothurner Arbeiterzeitung «Das Volk» gegen die Zensurbehörden im Zweiten Weltkrieg. Listige Redaktoren schmuggelten Berichte deutscher Flüchtlinge über die Konzentrationslager in Deutschland an der Zensur vorbei und ernteten dafür sogar Gefängnisstrafen. - Der Solothurner SP-Nationalrat und spätere Regierungsrat Jacques Schmid (1882-1960) wirkte nicht nur im Oltner Aktionskomitee, das den Generalstreik von 1918 ausrief, sondern er pflegte mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten aus der Dritten und der Vierten franz. Republik Léon Blum (1872-1950), der lebend aus dem KZ Buchenwald entkam, enge Kontakte. Blum besuchte Schmid auch in Solothurn. Schmid war auch schriftstellerisch tätig etwa mit seinem antifaschistischen Roman «Granita». Realistisch schildert er wie im Tessin eingeschleuste Naziagenten versuchen, Flüchtlinge zu terrorisieren. Der aus Oerlikon stammende Streikführer galt später dank seiner Menschlichkeit als Solothurner Staatsmann. -Eine aufrechte Arbeiterfrau und Mutter hat am Heiligen Abend des Jahres 1918 ihre Kinder nach Solothurn vor das Gefängnis geführt und ihnen erklärt, dort drinnen sitze der Ätti, weil er im November beim Streik einem Offizier seinen Säbel entrissen habe; den Säbel zerbrochen und die Teile in die Aare geworfen habe. Um der verletzten Offiziersehre willen sitze der Ätti nun dort. Diesen Anschauungsunterricht hätten die Kinder nie mehr vergessen und von an stets gewusst, auf welche Seite sie gehören. - Das Friedensabkommen in der Maschinen- und Metallindustrie von1937 zwischen von Roll-Gerlafingen Generaldirektor Ernst Dübi (1884-1947) und SMUV-Chef Nationalrat Konrad Ilg (1877-1954) wurde zur Grundlage für lange Jahrzehnte des Arbeitsfriedens in der Schweiz. - Das kleine Städtebundtheater Biel-Solothurn kann für sich in Anspruch nehmen, während der Hitlerzeit ein Zufluchtsort für Emigranten gewesen zu sein. Der aus dem zaristischen Russland geflüchtete Theaterdirektor Leo Delsen (1888-1954) tat sein Bestes in einem nicht immer freundlichen Umfeld für die aus Deutschland vertriebenen Theaterleute. - Es war der Solothurner SP-Bundesrat Willi Ritschard (1918-83), der öffentlich mahnend seine Stimme erhob damals in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als die Meinung aufkam, das durch Atomenergie-Gegner besetzte Gelände des geplanten AKW-Kaiseraugst sei militärisch zu räumen und zu besetzen. Er hat sich – wiewohl er Befürworter der Atomenergie war – durchgesetzt im Bundesrat. Willi Ritschard hat zum Entsetzen der Wortführer von politischer Grabesruhe und Ordnung 1980 in einem Zeitungsinterview während der sog. Zürcher Jugend-Unruhen warnend auf die Ursachen des Konfliktes hingewiesen und damit einen aufklärerischen Markstein gesetzt. Ritschard hat Ende 1973 auch klar den durch die USA inszenierten Putsch gegen den chilenischen Präsidenten Salvador Allende öffentlich verurteilt. - Es war der langjährige liberale Chefredaktor des «Oltner Tagblatt», Max R. Schnetzer (1925-2001), der während des Jurakonfliktes zur Vermittlung unter den Konfliktparteien beigetragen hat und somit als Mit-Wegbereiter der Gründung des Kantons Jura bezeichnet werden darf. - Auch der in Grenchen geborene, in Solothurn als Seminarlehrer tätige A. Jean Racine (1939-2003) hat als Bieler Monsieur Bilingue viel zur Verständigung unter den Sprachkulturen beigetragen. - Der 1931 in Solothurn geborene Soziologe Urs Jaeggi hat mit der 1966 publizierten Untersuchung «Der Vietnamkrieg und die Presse» die unter US-Einfluss verfälschte Berichterstattung der Schweizer Presse über den Vietnamkrieg entlarvt, dafür massive Schelte geerntet, letztlich seine Professur in Bern verlassen müssen und einen wesentlichen Beitrag zu einem etwas kritischeren Schweizer Journalismus geleistet. - Die Gründung der Gruppe Olten der Schriftsteller im Jahre 1971 fand wohl nicht nur aus verkehrstechnischen Gründen in Olten statt. Der Protest gegen die dumpfe Kalte-Krieger-Mentalität, die im 1969 vom Bund publizierten Zivilverteidigungsbuch hetzerisch gepflegt wurde und von etablierten Autoren aus dem Schriftstellerverband mitgetragen wurde, führte die kritischen Autoren in die Gruppe Olten, wo auch Peter Bichsel und Otto F. Walter (1928-94) mitwirkten. Walter hat denn auch etwa im Roman «Zeit des Fasans» bitter abgerechnet mit rechtsextremen autoritären Tendenzen. Und was ist geblieben? Wie manifestiert sich heute der Kampf um solothurnische Offenheit? - Zu reden ist von den Solothurner Filmtagen, wo stets auch von der Öffentlichkeit sonst kaum beachtete Filmer ihre Werke einem zunehmend grösseren Publikum zeigen können und damit dieser Gesellschaft den Spiegel vorhalten. - Zu reden ist von den Solothurner Literaturtagen, an denen kritische Stimmen den Zeitgeist beschreiben und seine Ungeist-Seiten aufzeigen. -Zu reden ist von den Oltner Kabaret-Tagen. Satirisch wird dort der scheinbar unveränderbaren Wirklichkeit zu Leibe gerückt. - Nicht unerwähnt bleiben darf die in Olten aufgewachsene Lilian Uchtenhagen, geb 1928, als tapfere Winkelriedin für die Frauenvertretung im Bundesrat. Sie war 1983 die allererste Bundesratskandidatin. - Zu reden ist von Schang Hutter, geb 1934, der damals 1998 sein Werk «Shoa» vor dem Haupteingang des Bundeshauses platziert hat gegen das Vergessen oder Verdrängen des Holocaust und um aufzuzeigen, dass in jeder Gesellschaft mindestens untergründig schlimme Ausgrenzungskräfte am Werk sind. Der Beweis ist ihm gelungen, Nationalräte der inzwischen de facto von der SVP aufgesogenen Auto-Partei liessen die Skulptur in einer feigen Nacht- und Nebelaktion abtransportieren. - Zu reden ist von Peter Bichsel, 1935 in Luzern geboren, in Olten aufgewachsen, in Lommiswil und Zuchwil als Lehrer tätig gewesen, in Bellach wohnhaft und dort in der Gemeinde tätig gewesen, in Solothurn (und in der Eisenbahn) schreibend, zu Solothurn gehörend als Europäer und Weltbürger, der seinen literarischen Durchbruch in Deutschland geschafft hat. Mahnend erhebt er seine Stimme immer wieder gegen Menschen- und Demokratieverächter. Selbst seiner SP liest er die Leviten, wenn er den Eindruck gewinnt, sie trage – wie bei einer Wahlkampagne 1995- mit ihrem Slogan zur Verluderung der politischen Sitten bei. - Zu reden ist auch vom knorrigen Schwarzbuben alt Bundesrat Otto Stich, geb. 1927, der sich nie scheute und auch heute nicht scheut, «Ross und Reiter» beim Namen zu nennen, wenn soziale, kulturelle Errungenschaften zu Schanden geritten werden sollen. Warum ich das alles aufschreibe: ich gebe die Hoffnung nie auf, dass sich immer wieder Solothurner/innen finden werden, die im Kampf um Freiheit, um Menschenwürde, für den sozialen Ausgleich der Devise folgen: Die Utopien von heute sind die Realitäten von morgen. Eigentlich geht letztlich immer um Zivilcourage. Und noch eines: wer mich des Lokalpatriotismus zeihen will, möge erfahren, dass ich finde, «Solothurn» könne überall vorkommen. Augenfreundlicher und schön illustriert auf Papier. (Bestellen können Sie das Buch «Leben am Jurasüdfuss» auf der Homepage des gab-Verlags) |
||