|
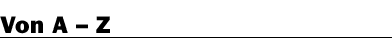
Berner Zeitung BZ vom 13.09.2004
«Die
Post macht einen guten Job»
Für
Ständerat Ernst Leuenberger ist die Poststellen-Initiative ein
Damm gegen «nicht absehbare Entwicklungen» bei der Post.
Nationalrat Duri Bezzola wendet sich gegen die Erhaltung überholter
Strukturen.
BZ:
Bis Ende dieses Jahres soll der Abbau des Poststellennetzes abgeschlossen
sein. Herr Leuenberger, was kann die Initiative denn zum jetzigen Zeitpunkt
noch bewirken?
 |
Der
Solothurner SP-Ständerat Ernst Leuenberger (links) und der
Bündner Nationalrat Duri Bezzola (FDP, GR) |
Ernst
Leuenberger: Seit der PTT-Reform von 1996/97 muss die Post in Konkurrenz
zu andern Anbietern funktionieren. Die Initiative verpflichtet sie auf
Verfassungsstufe –was heute nicht der Fall ist –die flächendeckende
Grundversorgung auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Es geht also nicht
um das Tagesgeschäft, sondern zukunftsgerichtet um die weiteren
Entwicklungen im Postbereich, die im Moment nicht absehbar sind.
Duri
Bezzola: Der Grundversorgungsauftrag der Post ist heute schon in
der Verfassung festgehalten. Weil sich das Umfeld für alle Unternehmen
fast täglich verändert, halte ich es für falsch, in der
Verfassung veraltete Strukturen festzuschreiben. Damit die Post eine
starke Schweizer Unternehmung mit sehr vielen Arbeitsplätzen bleibt,
muss sie sich dem Markt anpassen können. Sie hat einen Auftrag
der Politik, und sie macht das gut. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen,
es muss weitergeführt werden im Interesse einer starken und international
konkurrenzfähigen Post.
Ein
flächendeckendes Poststellennetz wollen alle, aber nicht alle verstehen
darunter das Gleiche. Wie interpretieren Sie diesen Begriff?
Bezzola:
Ich sage jetzt etwas Positives zur Initiative: Sie hat bewirkt,
dass das Postgesetz und die Postverordnung angepasst worden sind. Dort
ist das flächendeckende Poststellennetz definiert. Innerhalb von
20 Minuten muss eine Poststelle erreichbar sein, welche die Universaldienstleistungen
anbietet. Diese Dienstleistung für alle ganzjährig bewohnten
Siedlungen zu erbringen, ist in unserem Land nicht einfach. Ich komme
aus einer Randregion und weiss, was das bedeutet. Das heisst aber nicht,
dass überall vor Ort eine ständig bediente Poststelle auf
Kunden warten muss. Die Umsätze der Post bei Paketen, Briefen und
im Zahlungsverkehr nehmen als Folge der technologischen Entwicklung
laufend ab. Die Definition im Postgesetz ist deshalb für alle in
diesem Land absolut tauglich.
Leuenberger:
Die geltende Bundesverfassung hält lediglich fest, dass der Bund
über die Post legiferieren kann, über die Grundversorgung
sagt sie nichts. Richtig ist, dass das Postgesetz die Grundversorgung
umschreibt. Es geht aber um mehr als das Poststellennetz; es geht darum,
im Hinblick auf künftige, noch nicht absehbare Entwicklungen die
Grundversorgung zu garantieren. Dazu gehören ganz banale Sachen.
In meinem Quartier in Solothurn beispielsweise wurde der gelbe Briefkasten
bis vor wenigen Jahren auch am Samstag und Sonntag geleert, jetzt ist
vom Freitagabend bis Montagabend Schluss. Dieses banale Beispiel zeigt,
dass unter Finanzdruck eine Leistung abgebaut wurde, die meiner Meinung
nach durchaus zur Grundversorgung gehört. Die Poststellen spielen
eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit der Regionalpolitik. Wir wollen
mit dieser Initiative erreichen, dass im ganzen Land mit der Gewährleistung
der Grundversorgung auch Arbeitsplätze angeboten werden. Wir gehen
dabei vom Ist-Zustand aus, bei dem wir nicht wissen, wie er sich weiterentwickelt.
Darum gehört er in der Verfassung festgeschrieben.
Bezzola:
Ich komme aus einer Bergregion und kenne verschiedene Fälle, wo
Poststellen geschlossen und die Dienstleistungen mit dem Hausdienst
aufrechterhalten wurden. Selbstverständlich haben sich diese Gemeinden
anfänglich gewehrt, heute sind sie aber glücklich, denn der
Ersatz funktioniert. Wenn die Post jeden Tag gebracht und abgeholt wird,
bei jedem Wetter, bringt das den Regionen viel mehr als eine Poststelle,
die unter irgend einem Titel offen gehalten werden muss und von den
Leuten nicht benutzt wird. In den mir bekannten Fällen hat man
ernsthaft versucht, für jeden verlorenen Arbeitsplatz eine Alternative
zu finden. Strukturen zu erhalten, die nicht mehr gebraucht werden und
die sehr viel Geld kosten, ist stumpfsinnig.
Herr
Leuenberger, hinken Sie mit dieser Initiative der Realität hinterher?
Leuenberger:
Bundesrat Moritz Leuenberger, der die Initiative bekämpft,
hat gesagt, ein Ja des Volkes wäre «eine Liebeserklärung
an die Post». Es ist sogar mehr, ein Bekenntnis zum Service public.
Wir haben begriffen, dass in diesem vielsprachigen, dezentralen Land
die Post so etwas wie ein nationales Einigungssymbol ist– wie die
SBB und früher die Armee. Solche Institutionen gilt es zu stärken.
Nachdem sich das Postmonopol nicht mehr aufrechterhalten liess –nicht
zuletzt wegen der EU –und die Post dem Wettbewerb ausgesetzt wurde,
müssen wir dafür sorgen, dass die schweizerische Post, die
die ganzjährig bewohnten Siedlungen im hintersten Winkel bedient,
so gestärkt wird, dass sie diese Aufgabe erfüllen kann. Dafür
brauchen wir einen ganz klaren Auftrag in der Verfassung.
Herr
Bezzola, machen Sie sich als Vertreter einer Randregion keine Sorgen
um ein zunehmendes Stadt-Land-Gefälle bei der Versorgung mit öffentlichen
Dienstleistungen?
Bezzola:
Um das Stadt-Land-Gefälle mache ich mir grosse Sorgen. Aber
nicht wegen der Post, sondern ganz allgemein. In unseren Regionen haben
wir nichts anderes als den Tourismus, und aus dem müssen wir das
Beste machen. Damit er sich entwickeln kann, muss die Grundversorgung
bei Post, Telekommunikation, öffentlichem Verkehr und Energie sichergestellt
sein. Aber mit der Erhaltung überholter Strukturen entziehen wir
anderen Projekten der Regionalpolitik das Geld. Im Überlebenskampf
der Randregionen ist die Erschliessung mit dem öffentlichen und
individuellen Verkehr matchentscheidend, dort muss investiert werden.
Die
Post ist nicht so entscheidend?
Bezzola:
Doch, die Postdienste sind ebenfalls entscheidend. Aber mit den verbleibenden
2500 Poststellen sind diese Dienste gewährleistet.
Glauben
Sie daran, dass es beim Abbau auf 2500 Poststellen bleiben wird?
Leuenberger:
Ich bin felsenfest davon überzugt, dass dieses Projekt, das
von der Post unter Finanzzwang eingeleitet wurde, bei weitem nicht abgeschlossen
ist. Gegen diese vorstellbaren Entwicklungen muss ein Damm errichtet
werden.
Nötigenfalls
mit Bundessubventionen, wie es die Initiative vorsieht?
Leuenberger:
Postchef Ulrich Gygi wehrt sich gegen die Initiative, weil er als ehemaliger
Chef der eidgenössischen Finanzverwaltung weiss, wie schlecht man
bei Abhängigkeit von der Bundekasse gehalten wird. Er muss sich
aber vorwerfen lassen, immer noch den Traum zu träumen, die Feuerwehr
lasse sich rentabilisieren. Die Feuerwehr kann definitionsgemäss
nicht rentieren, und in einem gewissen Ausmass trifft das auch auf die
Post zu. Der Auftrag zur Grundversorgung, stehe er im Gesetz oder der
Verfassung, geht so weit, dass er auf Dauer durch die Post allein nicht
zu finanzieren ist.
Bezzola:
Die Post generiert ihre Finanzen unter anderem im Monopolbereich, von
dem wir nicht wissen, wie lange er noch besteht. Gegen die Rosinenpickerei
der Konkurrenz, die ihre Dienstleistungen nicht im Münstertal oder
Lugnez erbringen wird, kann der Bund Konzessionen erheben. Wenn diese
Abgaben nicht ausreichen, hat der Bundesrat schon heute die Möglichkeit,
dem Parlament eine Subvention für das Poststellennetz zu beantragen.
Mir genügt das vollkommen. Bei Subventionen, die auf Vorrat gesprochen
werden, würde ich als Post doch nicht die Leute verärgern
durch Effizienzsteigerung, Rationalisierungen und Umstrukturierungen.
Wenn das Geld nicht mehr reicht für die Grundversorgung, könnte
ich ja die Subventionen abholen. Die Post macht einen guten Job, steht
aber in einem brutalen Wettbewerb. 80 Prozent ihrer Erträge stammen
von Grosskunden, für die allein Qualität und Preis entscheidend
sind. Wenn man der Post schon eine «Liebeserklärung»
machen will, soll man in neue Technologien investieren, aber nicht in
überholte Strukturen.
Leuenberger:
Zu Zeiten der PTT hat der Telecombereich jahrzehntelang die Post hoch
subventioniert – mit 500 bis 800 Millionen pro Jahr. Bei der Trennung
von Telecom und Post haben wird es versäumt, die entstehende Finanzierungslücke
gründlich zu diskutieren. Und die damalige Führung der Post
hat verkündet, sie könne das Problem selber bewältigen.
Heute liefert die Swisscom AG erfreulicherweise ihrem Hauptaktionär
Bund jährlich hunderte von Millionen Franken ab. Was die Initiative
meint ist folgendes: Sollte die Post zur Gewährleistung der Grundversorgung
zusätzliche Gelder brauchen, sollen diese Mittel nicht durch den
Steuerzahler aufgebracht werden, sondern den gewaltigen Erträgen
des Telecombereichs entnommen werden. Ich gebe zu, dass wir als Parlament
es damals versäumt haben festzuhalten, dass hier eine Quelle offen
ist, für den Fall, dass alle Stricke reissen. Und weil wir das
versäumt haben, braucht es diese Initiative.
Bezzola:
Die Swisscom wird in Zukunft in einem härteren Markt bestehen müssen
(Stichwort: Diskussion rund um die letzte Meile) und den vollen Rucksack
brauchen. Zudem fliessen die Gewinne der Swisscom in die Bundeskasse,
und wenn daraus die Post subventioniert wird, fehlt das Geld beim Bund,
und das betrifft den Steuerzahler. Ich verstehe nicht, dass man angesichts
unserer Wachstumsprobleme Subventionen aufwenden will für Bereiche,
die ihre Dienstleistungen auf andere Weise selbsttragend erbringen können.
Das dürfen wir einfach nicht tun. Die Post, davon bin ich überzeugt,
wird besser funktionieren, wenn wir sie eigenständig halten.
Betroffen
sind auch die Städte. Dort kommt es teilweise zu erheblichen Wartezeiten
am Schalter. Hat die Initiative auch dagegen ein Mittel?
Leuenberger:
Die Initiative kann das Problem entschärfen, indem sie den
Finanzdruck auf die Post reduziert. In Genf, so wurde mir gesagt, gibt
es am Schalter Wartezeiten bis zu 40 Minuten.
Bezzola:
Dass es längere Wartezeiten gibt, habe auch ich erlebt. Inzwischen
hat sich die Situation durch organisatorische Massnahmen aber wesentlich
verbessert. Wer zum Beispiel bei der Bank Geld abheben will, muss auch
anstehen, darüber regt sich niemand auf.
Könnten
nicht kundenfreundlichere Öffnungszeiten das Problem beheben?
Leuenberger:
Sie spielen auf die Gewerkschaften an, die sich angeblich gegen längere
Öffnungszeiten sperren. Ich habe als Gewerkschafter die Erfahrung
gemacht, dass die Leute durchaus zu solchen Einsätzen bereit sind,
wenn man ihnen anständige Arbeitsbedingungen bietet.
|
|
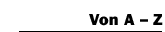 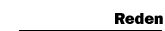  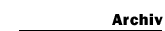 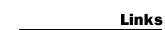 |