|
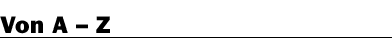
Schang
Hutter-Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn
Vernissage
12. Mai 2007. Freundesworte von Ständerat Ernst Leuenberger, Solothurn
 Wenig
legitimiert mich als Politiker über Kunst zu sprechen. Ja, ich
kann ihre Freiheit verteidigen, doch die Kunst geniesst Freiheiten wie
nie zuvor, und wo sich die Künstler mit ihren Werken an der Gesellschaft
reiben, Widerstand erzeugen, kommen sie ihrer ureigenen Aufgabe nach.
Über die gesellschaftliche Relevanz von Kunst darf und muss man
geteilter Meinung sein, doch ich spreche hier sicher im Sinne von Schang
Hutter. Und Schang ist ja in der Tat auch als politisch Engagierter
auf der Seiten der Schwachen, der Geplagten, der „Vertschaupeten“
aufgetreten und wahrgenommen worden. Wenig
legitimiert mich als Politiker über Kunst zu sprechen. Ja, ich
kann ihre Freiheit verteidigen, doch die Kunst geniesst Freiheiten wie
nie zuvor, und wo sich die Künstler mit ihren Werken an der Gesellschaft
reiben, Widerstand erzeugen, kommen sie ihrer ureigenen Aufgabe nach.
Über die gesellschaftliche Relevanz von Kunst darf und muss man
geteilter Meinung sein, doch ich spreche hier sicher im Sinne von Schang
Hutter. Und Schang ist ja in der Tat auch als politisch Engagierter
auf der Seiten der Schwachen, der Geplagten, der „Vertschaupeten“
aufgetreten und wahrgenommen worden.
Wir sprechen
dann halt mehr über Politik als über ästhetische Fragen;
mehr vom Geld, als von der Kunst. Wir werten Sicherheit höher als
historisches Bewusstsein. Zu Recht wird den Politikern von den Künstlern
Kleinmut vorgeworfen. So stritten wir 1998 sehr intensiv über Kunst
im öffentlichen Raum. Konkret: den Standort der Skulptur „Shoah“
von Schang Hutter vor dem Bundeshaus. Auf die berühmten drei Meter
Abstand von der Zentralachse werde ich später zu sprechen kommen.
Ich bin
ein Amateur, also ein Liebhaber der Kunst im Sinne des Wortes. Ich fälle
Geschmacksurteile, die ich nicht begründen muss; ich neige dazu,
die Moderne gegen die Postmoderne zu verteidigen, vielleicht bewundere
ich darum auch das Schaffen Schang Hutters in seiner Konsequenz, seinem
Beharren auf gesellschaftlicher Relevanz. Der Künstler selbst braucht
aber weniger pathetische Worte, verweist immer auf den Kern der eigenen
Erfahrung, der eigenen Person als Ausgangspunkt des Schaffens. Die Erfahrung
von Nachkriegsdeutschland etwa, die seine lebenslange Auseinandersetzung
mit der Gewalt und ihren verheerenden Folgen erklärt.
Eric Hobsbawn,
der englische Historiker stellt im Kapitel über die Kunst in seinem
grossen Werk über das Zeitalter der Extreme eine schöne –
wohl rhetorische - Frage, die uns vielleicht nahe an Schang Hutter bringt.
Hobsbawn fragt: „Wie viel Leidenschaft [für ein Kunstwerk]
beruht heutzutage auf Assoziation – also nicht etwa darauf, dass
ein Lied schön ist, sondern darauf, dass es ’unser Lied’
ist? Wir können es nicht sagen.“
Ende des
Zitats. Hutters Werke weckten stets meine Leidenschaften. Und die Leidenschaften
vieler anderer Menschen. Hutters Kunst rief aber auch viel Abwehr hervor,
was nicht weniger leidenschaftlich sein muss. Mit den Worten des Künstlers
selbst: Welches Ziel sollte denn die Kunst haben, wenn nicht dieses,
die Menschen zu erreichen?
Kunst im
öffentlichen Raum erfüllt heute andere Funktionen als in der
Gründerzeit der modernen Schweiz. Von der Repräsentanz der
Macht hin zu einer, wie es Hutter nennt seismografischen Funktion. Wie
eng umschlungen Politik und Kunst waren, zeigt ein kleines Detail. Der
Politiker, welcher in den 1890er-Jahren das Altdorfer Telldenkmal anregte,
diente dem Bildhauer Richard Kissling sogar als Modell. Freilich nur
für den Kopf, für den Körper fanden sich muskulösere
Männer… Die Staatskunst sollte aber bald ausgedient haben;
auch Denkmale, so der österreichische Schriftsteller Robert Musil
in den 30-Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem „Nachlass zu
Lebzeiten“, sollten sich heute, wie wir es alle tun müssen,
etwas mehr anstrengen! Ruhig am Wege stehen und sich Blicke schenken
lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von einem Monument
mehr verlangen.“ Schang Hutters Werke verlangen mehr!
1998 feierten
wir 200 Jahre Helvetik. Unter anderem gestalteten Künstler einen
Skulpturenweg von Grauholz - Ort der Niederlage des alten Berns –
bis vors Bundeshaus. Schang Hutter durfte die letzte Station des Weges
gestalten. Schang ist ein konsequenter Mensch, ihm ging nicht in den
Kopf, dass seine Skulptur „Shoah“, seine Auseinandersetzung
mit der düstersten europäischen Epoche nicht in der verlängerten
Mittelachse des Bundeshauses stehen sollte. Aus Sicherheitsgründen
beharrte die Verwaltung auf einen um drei Meter verschobenen Standort.
Hutter
sah das nicht ein. Mit gutem Grund. Gehen wir noch einmal zurück
ins vorletzte Jahrhundert. Betrachten wir etwa das Zürcher Denkmal
für Alfred Escher, erstellt 1889. Escher, mächtiger Bundesbaron,
Chef der Nordostbahn, Initiant der Gotthardbahn und der Schweizerischen
Kreditanstalt. Er ist ein typisches Beispiel dafür, dass die grossen
Unternehmer sich den städtischen Raum anzueignen begannen. Das
von Richard Kissling geschaffene Denkmal wurde auf einer wichtigen symbolischen
Achse errichtet, am Anfang der Zürcher Bahnhofstrasse, die bald
zum Zentrum der schweizerischen Hochfinanz wurde, und wo bereits 1873
der Sitz der Schweizerischen Kreditanstalt erbaut wurde. Es steht vor
einem idealen Hintergrund, dem Triumphtor des Bahnhofs (auf dem Helvetia
thront, umgeben von Industrie und Handel, und Escher und die Geschäftswelt
zu segnen scheint.
(In Klammern:
das ganz andersartige zeitgenössische Denkmal Vincenzo Velas für
die Opfer der Arbeit («Vittime del lavoro») bekam hingegen
erst 1932 seinen definitiven Standort in Airolo.
(Quelle:
Ars Helvetica VII. Die visuelle Kultur der Schweiz. Skulptur. Paul-André
Jaccard.)
Hutter
weiss um die Bedeutung von Mittelachsen. Er konnte nicht anders und
verschob die Skulptur vom bewilligten Standort um drei Meter vor den
Haupteingang des Bundeshauses. Mitten in der Diskussion um die Rolle
der offiziellen Schweiz im zweiten Weltkrieg eine folgerichtige Tat.
Als damaliger
Nationalratspräsident erteilte ich der Skulptur Bleiberecht am
idealen, aber nicht legalen Standort: Doch es sollte nicht ruhig bleiben.
Anfeindungen bleiben nicht aus, und schliesslich transportierten so
genannte Patrioten der Freiheitspartei „Shoah“ ab und spedierten
sie zurück zum Atelier des Künstlers. Indem sie von „Schrott“
sprachen, den sie entsorgten, meinten sie recht eigentlich „entartete
Kunst“ im widerlichen Sinne des NS-Faschismus. Hutters Skulptur
im öffentlichen Raum liess Risse aufklaffen, die uns; die mich
erschreckten und aufschreckten.
Ist es
heute ruhiger geworden um die Kunst? Lassen wir die Frage unbeantwortet.
Du Schang wirst unruhig bleiben und weiterarbeiten an deinem Handwerk,
als das du dein Schaffen immer in erster Linie verstanden hast. Dafür
danke ich Dir als Freund wohl auch im Namen vieler.
Informationen
zur Ausstellung
|