|
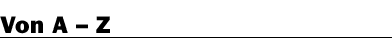
Wir
haben mit Jean Racine einen engen Freund verloren. Wir sind traurig.
«Du muesch denn auä no rede» - eine
Abschiedsrede von Peter Bichsel
Verliert eigentlich die Welt ihre Toten oder verlieren die Toten die
Welt? Wir, die wir hier versammelt sind, leben noch. Aber ich habe mit
Jean Racine eine Welt verloren, und ich weiss, dass mit mir noch viele
andere eine Welt verloren haben. Eine eigenartige Welt, die Welt des
Jean Racine - d Wäut vom André Jean, vom andere Jean. Eine
andere Welt. Und seine andere Welt ist ein Teil von unserer Welt geworden.
Immer, wenn Menschen sterben, die einem nahe waren, verliert man Welten,
aber ich habe es noch nie so heftig und so schmerzlich verspürt
wie mit Jean. Erlebt, Wie er sich nach und nach auflöste in das
Andere - und mir schien, dass er dabei ganz und gar Jean Racine wurde,
ganz und gar ein ging in die Welt des anderen Jeans. Ja, ich liebte;
ihn - ihn, der gern liebte und dem es ii wieder schwer fiel, geliebt
zu werden. Er hatte eine grosse Neigung zur Freundschaft, er bot diese
Freundschaft auch immer wieder grosszügig an - und wenn man sie
annehmen wollte, entzog er sich.
Irgendwie fürchtete er sich vor dem Grossen, vor der Grösse
der, Liebe, vor der Grösse der Musik, vor der Grösse des Theaters
und vor der Grösse der französischen Sprache. Das kleine Französisch
jener, die es nicht konnten, konnte ihn begeistern, das Theater jener,
die keine Schauspieler waren, faszinierte ihn - mit jenen, denen der
Sozialismus trotz allen Bemühens nicht so recht gelingen wollte,
war er gern zusammen Sozialist. Er hätte ein Meister werden können,
Talent war für ihn eine Selbstverständlichkeit - sein Talent,
auf Menschen zuzugehen, sein Talent, Leute zu überreden: Zum Singen
zu überreden, zur Politik zu überreden, zum Spielen, zum Unsinn
zu überreden. Er hätte ein grosser Meister wer den können
- er zog es vor, ein Kleinmeister zu sein. Er war nicht der Meister,
der uns begeisterte, er war der stille Kleinmeister, der uns rührte.
Er spielte seine Handorgel zwar meisterhaft, aber wenn man ihm zuhörte,
hatte man den Eindruck, es sei nicht schwer, und vielleicht könnte
man es auch. Jean machte uns die Kunst leicht, er machte uns das Singen
leicht, er machte uns das Spielen leicht, er machte uns das Französisch
leicht. Und in jenen Stunden der kleinen stillen Feste machte er uns
die Welt, das Leben leicht. Mitunter begeisterte er uns - das war ihm
oft peinlich. Denn so sehr er auch selbst begeistert sein konnte - ein
Begeisterter war er nicht, kein Fanatiker. Seine Handorgel, sein Langnauerli,
war etwas Pragmatisches - keine richtige Orgel, sondern nur ein Hilfsmittel,
mit dem man Menschen zusammenführen konnte. Keine grosse französische
Sprache, sondern nur eine kleine, die nicht seine Sprache war, sondern
die Sprache jener, die sie sprechen, wie mangelhaft auch immer - ein
Hilfsmittel, mit dem man Menschen zusammenführen kann, ein Mittel,
mit dem man Menschen verführen kann, vielleicht auch letztlich
zur Sprache verführen kann, zu jener grossen Sprache, von dem das
Grenchner-Lied erzählt, jenes Grenchner-Lied, das er so liebte
und uns lieben lernte:
Und wenn
der Himu papierig wär
Und jede Stärn e Schriber wär
Und jede hätti siebe Händ,
Sie chönnte mini Liebi
Ned schriebe z'änd.
Ein ernstes
Lied, und das Ernste hat seine Neigung zur Traurigkeit - und wem die
Neigung zur Traurigkeit fehlt, dem kann nichts ernst sein. Jean hat
uns immer wieder bei den lautesten Festen und übermütigsten
Feiern mit seinem Örgelchen die Sentimentalität zurückgebracht,
und mit ihr den Ernst.
Es war wunderschön, mit ihm zusammen Sozialdemokrat sein zu dürfen.
Der Weg ist das Ziel - das hat er uns beigebracht: Nämlich, dass
es nicht nur darum geht, etwas zu erreichen, sondern auch darum, etwas
zu sein und darin zu leben - die Sozialdemokratie wurde mit ihm sogar
zu einem Teil der bucheggbergischen Kultur. Wem, ausser ihm, dem Kleinmeister,
hätte so etwas gelingen können. Ich höre - wenn mir Sozialismus
einfällt - seine Handorgel: Lustig in der Traurigkeit, traurig
im Übermut, sanft im Ernst.
Wir beide pflegten früher, als es noch eine Tradition war, gemeinsam
eine Tradition. Wir gingen zusammen am Pfingstmontag ins inzwischen
alte YB-Stadion nach Bern zum Cupfinal. Ich freute mich jedes Mal darauf.
Es wurde zu einer richtigen grossen Reise, zu einer langen Reise. Und
wir wurden dabei zu zwei Buben, die das grosse Glück hatten, zum
Cupfinal gehen zu dürfen. Irgendwie ging es dabei nicht um Fussball
- es ging nur um die selbstverständliche Tradition der grossen
Reise zweier Buben zu einem grossen Ereignis. Und das grosse Ereignis
waren wir. Das konnte er, kleine Dinge zu grossen Ereignissen machen.
Und er machte sich ganz klein und bestaunte das grosse Ereignis. Und
Fussball, diese inzwischen kapitalistische Kampfsportart, wurde für
uns der Frieden. Wir hatten darin unseren Frieden. Seiner Frau Christine,
die mit ihm zusammen die deutsch-französische Spracharbeit machte,
sagte er einmal: "Weisst Du, was wir machen - das ist Friedensarbeit."
Es war, als der Cupfinal nicht mehr am Pfingstmontag, und schon lange
nicht mehr am Ostermontag stattfand und damit seine Tradition aufgegeben
hatte, nie mehr die Rede davon, dass wir hingehen könnten. Es wäre
nicht mehr die grosse Reise von zwei Buben gewesen - die grosse Reise
ins Abseits.
Robert Walser, der uns auch ab und zu, und ohne davon zu wissen, auf
unserer Reise begleitete, beschrieb es so:
Ich mache meinen Gang;
Der führt ein Stückchen weit
Und heim; dann ohne Klang
Und Wort bin ich beiseit.
In den Worten von Jean Racine, der dieses Gedicht liebte, hiess dasselbe,
als ich zum letzten Mal mit ihm zusammen war, pragmatisch, still und
unpathetisch:
"Du muesch denn auä no rede."
10.01.2004
|
|
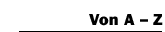 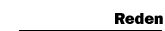  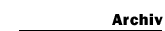 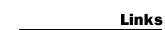 |