|
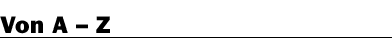
Referat zum 1. Mai 2002 in Burgdorf / BE
Ständerat
Ernst Leuenberger, Präsident SEV, Solothurn
Es gilt
das gesprochene Wort!
Der Grundgedanke
der Maifeierbewegung hat auch nach über 100 Jahren seine Gültigkeit
nicht verloren und das erst recht unter Bedingungen einer zunehmend
globalisierten Wirtschaft: Sozial Schwächere können ihre Rechte nur
erkämpfen, wenn sie sich international zusammenschliessen. Solidarisches
Verhalten ist gefragt über alle Grenzen von Staaten, Sprachen, Religionen,
Rassen und Kontinenten hinweg.
Am Internationalen
Arbeiterkongress von 1889 in Paris ging es darum, die heillos zerstrittene
internationale Arbeiterbewegung hinter mindestens einer einheitlichen
Forderung zusammenzubringen. Man schrieb die Erkämpfung des 8-Stunden-Tages
auf die Transparente und einigte sich darauf, inskünftig jährlich am
1. Mai für diese Forderung in allen Ländern zu demonstrieren.
Wichtig
war und ist die Erkenntnis, dass diese Forderung nur eine Chance haben
konnte, wenn sie weltweit erhoben und durchgesetzt wird. Das Argument
der Gegenseite, die Konkurrenzfähigkeit werde bei der Gewährung von
Arbeitszeitverkürzungen nur in einem Land dort massiv beeinträchtigt
entfiele damit automatisch.
So steht
denn seit jenen Tagen der Gedanke der internationalen Solidarität im
Zentrum aller sozialen Bewegungen, die sich zur Maifeierbewegung zählen.
Solidarität
üben ist schwierig. Solidarität ist nur dann etwas wert, wenn sie auch
etwas kostet. Das braucht nicht unbedingt Geld zu bedeuten. Es kann
auch eine Anstrengung sein, anderen beizustehen, andere zu akzeptieren.
Schritte unternehmen zu andern, zu Unbekannten, zu Fremden. Das alles
gehört dazu. (Solidarität heisst teilen)
Solidarität
üben heisst damit schlicht und einfach teilen, teilen lernen.
Wir alle
wissen aus unseren Kindheitstagen, auch aus unserer Erziehungsarbeit
als Eltern oder Grosseltern, wie schwierig es ist, teilen zu lernen.
Aber wir wissen auch, wie wichtig es ist zu teilen. Schwieriges Teilen
bei einer Gegenmentalität: "Selber essen macht fett", " Wenn jeder für
sich selber schaut, ist für alle gesorgt."
- Wir
können Arbeit teilen. Arbeit kann besser verteilt werden. Arbeit und
damit Erwerbseinkommen können besser, gerechter aufgeteilt werden
auf alle Köpfe und Hände.
- Einkommen
kann geteilt werden mit Einkommenslosen. Das kann auch heissen, dass
ich Sozialversicherungs-prämien bezahle, damit eine anständige Arbeitslosen-versicherung
möglich wird für die Betroffenen.
- Es
kann auch heissen, dass ich bereit bin, das Stimmrecht zu teilen,
mit denjenigen, die kein Stimmrecht haben.
- Das
heisst auch, sauberes Wasser und saubere Luft, ja ein Stück intakter
Natur teilen mit unseren Nachfahren, auch den noch Ungeborenen. (Solidarität
heisst auch Kampf gegen jegliche Diskriminierung)
Das muss
heissen, dass ich nicht zulasse, dass in meiner Umgebung diskriminiert
und unterdrückt wird. Das muss heissen, Zivilcourage zu haben und einzuschreiten.
Unsere Solidarität hat all jenen zu gelten, die unterdrückt und verfolgt
werden. Unsere Solidarität gilt weltweit denjenigen, die heute nicht
wissen, was sie morgen ihren Kindern zu essen geben sollen. Unsere Solidarität
gilt denjenigen, die auch bei uns, hier und jetzt bedrückt und verzagt
sind und keine Zukunft vor sich sehen. Wer von Solidarität spricht,
muss jenen politischen Kräften die Stirne bieten, die nichts als Egoismus,
Eigennutz und Ausgrenzung anderer im Sinne haben.
Wenn auch
in der Schweiz die äusserste Rechte Wahlerfolge feiert, die auf der
Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger beruhen, nachdem man zuerst
durch Angstmacherei die Leute verunsichert hat, ist dieser Zustand alarmierend
und verlangt entschieden Gegensteuer. Die Gewerkschaften, die Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter; die politischen Parteien im rot-grünen Bereich,
mit echt liberalen bürgerlichen Kräften müssen heute entschieden aufstehen
gegen den Rechtspopulismus der professionellen Vereinfacher.
Wer mit
Fremdenfeindlichkeit Stimmung macht und so Wahlen gewinnt, spielt mit
dem Feuer. Wir sind als Feuerwehr gefragt, wir alle. Und noch eines:
Wenn vereinzelte Strategen der bürgerlichen Mitte meinen, durch Nachgiebigkeit
könne man diesen Kreise Meister werden, täuschen sie sich gewaltig.
Nur eine klare Haltung bewahrt die Grundlagen des eidgenössischen Zusammenlebens,
die da heissen: sozialer Ausgleich, friedliches Zusammenleben der Sprach-und
Kulturgemeinschaften. (Bürgerliche und Wirtschaftskapitäne wollen nicht
teilen)
Marcel
Ospel, Chef der UBS, kassiert 12,5 Mio Franken pro Jahr, eine Million
pro Monat, 60'000 Fr. pro Arbeitstag. An einem Tag so viel wie durchschnittliche
Lohnabhängige im Jahr, und doppelt so viel wie noch immer manche sog.
"working poor", Leute, die arbeiten und trotzdem arm sind, im Jahr verdienen.
Von "verdienen" kann man bei einer Million pro Monat nicht sprechen.
Auch das
Wort Selbstbedienung beschönigt den Sachverhalt. Die Bezüge der Barnevik,
Ospel und Konsorten bedeuten nichts anderes als Plünderung, Diebstahl
- oder Aneignung im Sinne der ursprünglichen Akkumulation, jedenfalls
das Gegenteil der Interessen der Unternehmen, die zu führen sie eigentlich
verpflichtet sind. Ein Verhalten, bei dem einfachere Leute, wenn es
um bescheidenere Summen geht, hinter Gittern landen.
Zur Schamlosigkeit
der Manager gibt es ein politisches Begleitprogramm: Die Senkung der
Steuern für die Reichen, und jetzt neu die Befreiung der hohen Löhne
- der Löhne über 106'000 Franken - von Beiträgen an die Arbeitslosenversicherung,
begleitet von der Bestrafung der Langzeitarbeitslosen durch die Kürzung
der Bezugsdauer für die Taggelder um ein halbes Jahr. Bei der Schaffung
der AHV 1947 war es noch selbstverständlich, dass auf allen Einkommen
- auch den höchsten - AHV-Beiträge bezahlt werden müssen, obwohl niemand
mehr als die Maximalrente erhalten kann. Diese Solidarleistung der Reichen
ist auch heute nötig.
Steuergeschenke
und Beitragsgeschenke für die Ospels, Leistungsabbau bei den Arbeitslosen:
Dieses politische Programm von FDP, SVP und CVP bekämpfen wir mit dem
Referendum gegen die Revision der Arbeitslosenversicherung. (Kampf gegen
den Taggeld-Abbau in der Arbeitslosenversicherung)
Viele von
Euch wissen, was Arbeitslosigkeit ist. Ihr wisst, was der Kampf für
Arbeitsplätze bedeutet, und was es heisst, auf die Arbeitslosenversicherung
angewiesen zu sein. Eine Versicherung muss funktionieren, wenn das versicherte
Risiko eintrifft. Das Risiko Langzeitarbeitslosigkeit ist für die Betroffenen,
für ihre Familien eine soziale, eine psychische und eine finanzielle
Katastrophe.
Umso wichtiger
ist es, dass wenigstens die Arbeitslosenversicherung funktioniert, erst
recht, wenn die Arbeitslosigkeit länger dauert. Die Urheber des Abbaugesetzes
spekulieren darauf, dass die Langzeitarbeitslosen ja nur Minderheit,
eine verhältnismässig kleine Minderheit der Bevölkerung sind. Aber schon
einmal, beim Abbau der Taggelder der Arbeitslosenversicherung vor fünf
Jahren, haben sich die Sozialabbauer verrechnet, stand die Mehrheit
in der Volksabstimmung nicht auf der Seite der geschlossenen bürgerlichen
Parteien, sondern auf der Seite der sozialen Bewegungen, auf der Seite
der Solidarität mit der Minderheit der Arbeitslosen.Genauso
wie beim erfolgreichen Referendum gegen die von den Bürgerlichen beschlossene
Abschaffung der Viertelsrenten in der Invalidenversicherung auf der
Seite der Teilinvaliden.
Das Referendum
1997 ging von dieser Region aus, vom Komitee von La Chaux-de-Fonds.
Die sozialen Bewegungen können auch unter widrigen Bedingungen etwas
erreichen, falls sie kämpfen. Wir, die Gewerkschaften, die Linke, sind
gezwungen, in diesem Jahr zwei Referendumskämpfe zu führen, zwei Referenden,
die wir gewinnen können, und die wir gewinnen müssen, im Dezember gegen
den Abbau bei der Arbeitslosenversicherung, und schon im September das
Referendum gegen die Strommarktliberalisierung. Es sind zwei wichtige
Referenden für die Zukunft der Schweiz, der politischen und sozialen
Schweiz.
Wir haben
die Chance, diese Auseinandersetzungen zu gewinnen, wenn wir kämpfen,
der politischen Uebermacht auf der Gegenseite zum Trotz. (Strommarktliberalisierung:
Kampf um den service public) Die Strommarktliberalisierung setzt die
Qualität des Service Public aufs Spiel. Heute haben wir in der Schweiz
eine hohe Versorgungssicherheit. Ausfälle der Stromversorgung wie in
Kalifornien und Schweden nach der Liberalisierung können wir uns nicht
vorstellen. Der Wasserkraftanteil in der Schweiz ist hoch. Niemand wird
von den Strompreisen erdrückt, im Gegensatz zu den Krankenkassenprämien.
All das
verdanken wir den öffentlichen Werken, dem demokratischen Einfluss,
der starken Stellung der öffentlichen Hand auf der Ebene der Gemeinden
und der Kantone. Das ist die Errungenschaft von Generationen, welche
die Stromversorgung nicht dem Markt, nicht den privaten Konzernen überlassen
wollten, mit guten Gründen. Warum soll jetzt diese öffentliche Stromversorgung
zerschlagen werden, obwohl sie gut funktioniert? Weil mit der Liberalisierung
hohe Gewinne zu erzielen sind, Gewinne für die Konzerne, die nicht vom
Himmel fallen, sondern von den gewöhnlichen Konsumentinnen und Konsumenten
bezahlt werden müssten. Enron, die grösste Firmenpleite in den USA,
Spekulation, Manipulation, Lug und Trug, ist das Produkt der amerikanischen
Elektrizitätsmarktliberalisierung. Jetzt ist das Enron-Stromhandelsgeschäft
von Marcel Ospels UBS übernommen worden, in freudiger Erwartung der
Gewinne, die mit den liberalisierten Energiemärkten zu erzielen sind.
Und in Kalifornien, z.B. in San Francisco, gibt es wieder erfolgreiche
Volksinitiativen für eine öffentliche Stromversorgung, also exakt für
das, was wir schon heute haben.
Für die
Economiesuisse, den mächtigen Dachverband der Wirtschaft (Früher Vorort),
ist das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) der entscheidende Testfall für
die Politik der Liberalisierung und Privatisierung des Service Public.
Aber trotz der Unterstützung durch die bürgerlichen Parteien, trotz
der Unterstützung durch die Atomlobby und die Kantonsregierungen, trotz
dieser gewaltigen Uebermacht wissen die Strategen der Economiesuisse
nur zu gut, dass sie den Abstimmungskampf ohne linke Feigenblätter nicht
gewinnen können - denn zu offensichtlich sind die Nachteile für Konsumentinnen
und Konsumenten und für die Versorgungssicherheit.
Die Weissbuchapologeten
der Economiesuisse, die Ospels und die Mühlemanns, wagen längst nicht
mehr zu behaupten, dass die Strommarktliberalisierung der Bevölkerung
eine bessere Versorgung und sinkende Preise bringt, weil es erstens
nicht stimmt und weil ihnen das zweitens niemand glauben würde. Die
Linke kann das Referendum gegen das EMG gewinnen. Aber damit wir gewinnen,
braucht es einen grossen Einsatz und vor allem eine klare Sprache, nach
innen und gegen aussen, und die Entlarvung der Interessen, die hinter
der Strommarktliberalisierung stehen. Wenn wir das Referendum gewinnen,
dann ist das ein starkes Signal für einen leistungsfähigen Service Public
im Interesse der Bevölkerung, weit über die Stromversorgung hinaus.
Denken
wir beispielsweise an die unverantwortlichen Pläne bei der Post, die
dieses Bundesunternehmen in wenigen Jahren kaputtzumachen drohen, und
damit die postalische Versorgung der Regionen abseits den grossen wirtschaftlich
dominierenden Zentren. BR Couchepin meint, ökonomisch gesehen würden
800 Poststellen für die Schweiz genügen. Das sagt er unverfroren in
einem Zeitpunkt, wo noch weit über 3000 Postbüros existieren. Die Lebensqualität
der Schweiz beruht entscheidend auf funktionierenden öffentlichen Dienstleistungen,
unter Einschluss des öffentlichen Verkehrs und der Bildung. Verteidigen
und erweitern wir diese Errungenschaften, im Interesse der grossen Mehrheit
der Bevölkerung. Das Referendum vom September ist dafür ein wichtiger
Testfall.
Es gibt
Dinge, die zu wichtig sind, um sie dem Markt, den Konzernen, den Profiteuren
und Spekulanten zu überlassen.
Der Erfolg
der GBI ist ein starkes Signal auch in Richtung der Frühpensionierung
in der AHV, die seit Jahren im Parlament blockiert wird. Solange die
Bürgerlichen meinen, dem Volk ein Abbauprogramm verordnen zu müssen,
werden wir die Revision bekämpfen. Es wird Zeit, statt Steuergeschenken
für die Reichen die Frühpensionierung für alle einzuführen und die Renten
wieder zu verbessern. Die AHV ist für die Leute mit unteren und mittleren
Einkommen die Basis der Altersvorsorge. Deshalb braucht es die soziale
Frühpensionierung in der AHV.
Der 1.
Mai steht dafür, dass es Perspektiven der sozialen Entwicklung gibt,
unabhängig von der Herkunft und unabhängig von den nationalen Grenzen.
Dass gegen die gefährlichen Tendenzen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Ausgrenzung eine lebendige Bewegung existiert, die sich an den Interessen
der Arbeitenden orientiert.
Oder wie
in Porto Alegre formuliert worden ist: Eine andere Welt ist möglich.
Dieses
Schweizerland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land
brauchen Gewerkschaften, mehr Gewerkschaften, überall Gewerkschaften.
Gewerkschaften auch in den "neuen" Branchen.
Der Gedanke
der gewerkschaftlichen Organisation muss von und und durch uns noch
mehr verbreitet werden. Es sei nicht modern, organisiert zu sein. So
verkündet es der neoliberale Zeitgeist und seine Hohepriester. Jeder
sei seines eigenen Glückes Schmied. Einigen wenigen mag das gelingen,
wenn sie rücksichtslos genug vorgehen. Der Maifeierbewegung geht die
Arbeit nicht aus. Die hohen Ziele "internationale Solidarität" und Schaffung
sozialer Gerechtigkeit hier im Lande und weltweit erfordert unser aller
Einsatz. Dieser 1.Mai 2002 ist uns Anlass, unser Versprechen, den Zielen
der Maifeierbewegung zu dienen mit freudigem Einsatz zu erneuern und
zu bekräftigen.
Und noch
einmal: Eine andere Welt ist möglich.
|
|
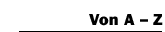 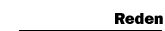  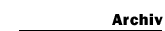 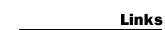 |