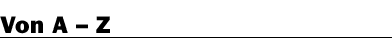
Ansprache
von Ständerat Ernst Leuenberger am Brückwachtschiessen in Bätterkinden
am 4. März 2001
Herzlichen
Dank für die Ehre, hier an Ihrem Gedenk- und Wettkampfanlass sprechen
zu dürfen. Kräiliger sind immer stolz, wenn sie in Bätterkinden etwas
sagen dürfen. Ich bin heute hier bei Ihnen als solothurnisch-bernischer
Grenzgänger, der sehr froh ist, dass es an der Kantonsgrenze zwischen
Lohn und Bätterkinden keinen Zollposten mehr gibt. (Sie glauben es kaum,
aber auch diese Tatsache hat mit den Märzereignissen von 1798 etwas
zu tun).
Vorerst
gilt es, den teilnehmenden Schützen Anerkennung auszusprechen für ihr
Mitwirken am sportlichen Wettkampf. Den ausgezeichneten Schützen und
ihren Gesellschaften gratuliere ich herzlich zu ihrem sportlichen Erfolg.
Sodann
wollen wir der Ereignisse vom März 1798 in würdiger Weise gedenken.
Sicher gedenken wir insbesondere der Opfer dieser kriegerischen Ereignisse
und damit auch der Opfer aller seitherigen und aktuellen Kriege.
Echtes
Gedenken ist geprägt von Versöhnlichkeit, von Friedfertigkeit. So sagt
uns etwas Shimon Peres: Frieden schliesst man mit seinen Feinden; nicht
mit Freunden. Darum ist Frieden schliessen so ungemein schwierig.
Ich füge
bei: Ziel unseres Wirkens in der Oeffentlichkeit wie im Privaten ist
eigentlich immer Harmonie. Die Realität aber ist voller Konflikte. Unsere
Klugheit wird daran gemessen, wie wir die auftretenden Konflikt lösen.
Wir fragen
dann weiter nach den historischen Fakten und danach, was diese Ereignisse
bewirkt haben. Letztlich auch die Frage: was lehrt uns dieser geschichtliche
Abschnitt?
Die historischen
Fakten sind schnell erzählt: Die französischen Revolutionsheere wollen
die bernischen Untertanen von ihren Aristokraten befreien (und beiläufig
noch den bernischen Staatsschatz mitsamt den Bären nach Paris überführen).
Am 1. März 1798 kapituliert die stolze Stadt Solothurn ohne grössere
Kämpfe. Die Franzosen nähern sich südwärts bernischem Gebiet. Die Stationen,
welche die offizielle Geschichtsschreibung über diesen Vormarsch verzeichnet,
heissen Fraubrunnen (Tafelenfeld), Grauholz und Einmarsch in Bern, womit
das alte patrizische Bern untergeht. (Ich vergesse den Berner Sieg in
Neuenegg keineswegs). Die Kämpfe in unserer Gegend sind meisterhaft
beschrieben in Gotthelf "Elsi, die seltsame Magd".
Tatsache
ist, dass bei den bernischen Truppen viel Misstrauen, Missmut und grosse
Unsicherheit herrschten. Das Ancien Regime des bernischen Patriziats
hatte sich in jahrhundertelanger Herrschaft verbraucht, war morsch geworden,
hatte sich zu weit vom Volk entfernt, dessen Unterstützung verloren.
Mit dem
Untergang der alten Eidgenossenschaft verschwinden auch die kantonalen
Zollgrenzen. Aus den Ruinen der alten Eidgenossenschaft ist dank der
Tatkraft der damals Aufbauwilligen neues, zukunftsträchtiges entstanden.
Der Bundesstaat von 1848, auf dessen Fundamenten unsere heutige Schweiz
aufgebaut ist, wäre ohne die Ereignisse von 1798 nicht möglich geworden.
Der Aufbau
des jungen Bundesstaates war wesentlich geprägt durch die neu entstehenden
Vereine: Schützengesellschaften, Turnvereine, Gesangs- und Musikvereine
prägten das patriotischen Leben des 19. Jahrhunderts ganz entscheidend
mit.
Es kommt
nicht von ungefähr, dass Gottfried Keller in seinem "Fähnlein der sieben
Aufrechten" den Schützen ein einzigartiges literarisches Denkmal gesetzt
hat.
Der Zusammenhang
zwischen dem staatlichen Neuaufbau und dem Wirken der Vereine kommt
deutlich in der Festrede des jungen Karl Hediger zum Ausdruck, wenn
er am Eidg. Schützenfest namens der kleinen Gruppe von Zürcher Schützen
in seiner Grussadresse unter dem Titel " Freundschaft in der Freiheit"
ausführt:
"Wie
kurzweilig ist es, dass es nicht einen eintönigen Schlag Schweizer,
sondern dass es Zürcher und Berner, Unterwaldner und Neuenburger, Graubündner
und Basler gibt, und sogar zweierlei Basler. Dass es eine Appenzeller
Geschichte gibt und eine Genfer Geschichte. Diese Mannigfaltigkeit in
der Einheit, welche Gott uns erhalten möge, ist die rechte Schule der
Freundschaft..."
Und es
ist und bleibt wahr: Sieben Millionen Einwohner machen keine Schweiz
aus. Die Schweiz besteht aus den Kantonen, den Gemeinden, aus den Vereinen
und Gruppen, aus den Verbänden, aus Freundeskreisen. Die Schweiz besteht
aus Sprachgruppen, aus Gruppen religiöser Zugehörigkeit. Die Schweiz
besteht aus Alten und Jungen, Frauen und Männern, aus Sportlern und
Kulturschaffenden, aus Angehörigen aller Berufe. Sie besteht aus Menschen
verschiedener Hautfarbe, verschiedener politischer Auffassungen.
Die Einheit
besteht in der Vielfalt.
Die Konflikte sind damit vorgegeben.
Die Konfliktlösungen sind gefragt.
Wesentliche Elemente aller Konfliktlösung sind und bleiben:
- der
soziale Ausgleich zwischen oben und unten
- der
regionale Ausgleich
- die
Verständigung unter den Sprach- und Religionsgemeinschaften
- die
Verständigung mit den Völkern und Staaten Europas und der Welt
Das ist
der nationale Grundkonsens der Schweiz und der Schweizerinnen und Schweizer.
Das ist das, was in der eidg. Eidesformel heisst: ... " die Einheit,
Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu wahren..."
Das heisst
auf neudeutsch übersetzt: Schweizer kann man nicht einfach outsourcen.
Einige
Gedanken zu diesen Elementen der Konfliktlösung:
- sozialer
Ausgleich heisst: wir können nicht tatenlos zusehen, wie die Schere
in der Einkommens- und Vermögensverteilung zwischen unten oben sich
weiter öffnet und unüberwindbare Differenzen entstehen lässt. Das Gerechtigkeitsgefühl
der Eidgenossen wird verletzt, wenn ganz oben mit der ganz grossen Kelle
angerichtet wird und unten der Schmalhans Küchenmeister werden soll.
Die Verteilungsfrage ist und bleibt eine zentrale Frage für den inneren
Zusammenhalt einer Gesellschaft.
- Der
regionale Ausgleich ist ebenso wichtig. Entvölkerte Bergtäler und Landstriche
und übervölkerte Städte ergeben keine Schweiz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft
ist keine Schweiz AG, sie ist eine Solidargemeinschaft. Kluge politische
Massnahmen fördern diesen regionalen Ausgleich. Der Bund und seine Bundesbetriebe
Bahn und Post z.B. können nicht die Versorgung der Landschaft dem Markt
überlassen. Der Markt ist - dem Herrn sei es geklagt - regionalpolitisch,
sozial und auch ökologisch blind wie ein neugeborenes "Kätzchen".
- Die Sprachgemeinschaften
müssen zusammengeführt werden, nicht durch Gräben getrennt. Mein Vater,
der von der Geburt bis zum Tod in dieser Gemeinde gelebt hat, verstand
und sprach französisch. Er war als Bauernsohn im "Welschen".
- Das schwierigste
von allem bleibt die Verständigung unter den Völkern. Nicht nur geografisch,
auch wirtschaftlich liegt die Schweiz mitten in Europa. Sie wird mit
ihren Nachbarn und deren Organisationen in Zukunft einen modus vivendi
finden müssen. Ob das dann EU-Beitritt oder was auch immer heissen wird,
muss sich weisen. Jedenfalls haben Fremdenfeindlichkeit und Isolationismus
in dieser vernetzten Schweiz-Welt keinen Platz. Vielleicht könnte es
uns Schweizern gar gelingen, EU-Europa davon zu überzeugen, dass die
vielfältige Schweiz durchaus ein Muster für ein vereintes Europa darstellen
könnte.
Ich schliesse
damit, dass ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke, Ihnen Anerkennung
ausspreche für Ihren Dienst an der Gemeinschaft, Sie ermuntere weiterhin
am Schicksal des Landes lebhaften Anteil zu nehmen. Oder eben mit Karl
Hediger geredet: die Freundschaft in der Freiheit zu pflegen.
|