|
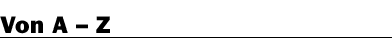
Rencontres
Suisses
Tagung
29.4.2002
Referat
Ernst Leuenberger, Präsident SEV (Schweiz. Eisenbahn- und Verkehrspersonalverband)
Vorbemerkung:
Ueber service public reden, heisst für mich auch immer über den Staat
und die Bürger/innen reden.
Thesen:
Der
citoyen schafft sich den demokratisch verfassten Bürgerstaat. Dieser
Bürgerstaat befördert die Wohlfahrt seiner Bürger/innen und schafft
für das Wirtschaften optimale Rahmenbedingungen.
Der schweizerische Bundesstaat fundiert eben auf den Werten der französischen
Revolution und orientiert sich nicht am preussischen Obrigkeitsstaat.
Dieser Staat beschränkt sich nicht auf die rein hoheitlichen Funktionen
wie Polizei und Justiz, sondern er erstellt und betreibt die jeweils
nötige Infrastruktur in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Verkehr.
Der
citoyen versteht sich auch als Wirtschaftsbürger schafft sich service
public-Institutionen zur Garantie der Grundversorgung mit wichtigen
Gütern und Dienstleistungen.
Gemeint ist die Grundversorgung mit knappen, lebenswichtigen Gütern,
die u.U. nicht rentabel im betriebswirtschaftlichen Sinne für alle erbracht
werden können. Die extremste Form dieser öffentlichen Dienstleistungserbringung
stellt wohl die bspw. aus dem Weltkrieg
bekannte Rationierung für Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Seife usw.
dar. Historisch bekannt sind auch die kantonalen Salzregale, die inzwischen
als überflüssig aufgehoben werden konnten. Als zentrale Bereiche des
service public (neben den hoheitlichen Staatsaufgaben) gelten heute
etwa:
- Wasserversorgung
- Schulen
- Öffentlicher Verkehr
- Entsorgung
- Post
- Gesundheit
- Energieversorgung
- Feuerwehr (kein vernünftiger Mensch redet von
. einer Rentabiliserung dieses service public).
Service public ist mithin für die allermeisten ctoyens keine "Maskerade"
wie die NZZ meint, sondern ein gesellschaftliches Muss. Milliardäre
brauchen nämlich keinen service public, ja nicht einmal einen Staat;
sie können sich alles auf dem Markt kaufen. Die Citoyens aber sind auf
die Solidargemeinschaft aller Bürger/innen im Staat angewiesen.
Service
public Grundversorgung hat flächendeckend, allgemein zugänglich und
zu erschwinglichen Preisen angeboten zu werden.
Daraus ergibt sich die Zuschusspflicht der öffentlichen Hand für die
nicht rentabel zu erbringenden service public Dienste. Enthalten ist
in dieser Aussage ein starkes regionalpolitisches Element, aber auch
ein sozialpolitisches.
Der
Wirtschaftsbürger - Citoyen behält sich als Miteigentümer der Service
public-Institutionen das letzte Wort über diese Institutionen über den
Weg demokratischer Entscheide vor. Mit dazu gehört die demokratische
Kontrolle durch die gewählten Behörden.
Ich trete damit der These der Enkel der Staatsgründer (FdP) entgegen,
die heute glauben, ein service au public genüge vollauf. Wer den erbringe,
sei Sache privaten Unternehmertums. Ueber öffentliche Leistungsaufträge
liesse sich alles regeln. Alle Privatisierungskonzepte sind in diesem
Sinne zutiefst undemokratisch, wenn nicht gar antidemokratisch gemeint;
mindestens sind sie nicht bürgerfreundlich. Der Schlachtruf von 1898
(als der Staatsgründerfreisinn noch 6 von 7 Bundesräten stellte); der
Schlachtruf "Die Schweizerbahnen dem Schweizer Volk" hat seine Gültigkeit
nicht verloren wie die Volksabstimmungen von 1998 (LSVA und FinöV) zeigen.
Die kürzlich eingereicht Volksinitiative "Postdienste für alle" bestätigt
meine These. Dass die demokratische Bewegung im 19. Jahrhundert etwas
gar weit ging mit dem Beschluss etwa im Kanton Solothurn auch die Salzauswäger
in einer Volkswahl zu erküren, räume ich durchaus ein. Allerdings vermute
ich, es wäre den Bund billiger gekommen, bei der alten Swissair etwas
früher zum Rechten zu sehen.
Der
Wirtschaftsbürger-Citoyen schafft und stützt im service public solide,
krisensichere Arbeitsplätze für die service public-Angestellten.
Im service public sind prekäre Arbeitsbedingungen nicht nur im Empfinden
der dort Beschäftigten, sondern auch im Empfinden der citoyens weder
wünschenswert noch tolerierbar. Im Gegenteil: der Bund und seine Unternehmungen
mit rund 130 000 Angestellten bildeten und bilden ökonomisch einen Stabilitätsfaktor
wie verschiedene Beschäftigungskrisen der letzten Jahrzehnte gezeigt
haben. Der Bund und seine Unternehmungen mit ihrer oben und unten gestauchten
Lohnskala, mit gesamtschweizerisch im Prinzip gleichen Anstellungsbedingungen
hatten und haben eine wichtige Funktion des sozialen Ausgleich und auch
des regionalen Ausgleichs. Wer mit den rein betriebswirtschaftlich denkenden
Verwaltungsräten von Post und SBB meint, die Top-Manager vergolden zu
müssen und die Lohnskala nach unten öffnen zu müssen, der zerstört mutwillig
ein zentrales Element des schweizerischen sozialen Friedens und des
regionalen Ausgleichs.
Der
service public-Angestellte versteht sich als Diener an der Allgemeinheit.
Er arbeitet zum Wohle aller und nicht für den Profit Einzelner. Er ist
Mitarbeiter einer Non-Profit-Organisation.
Der
service public-Angestellte identifiziert sich überdurchschnittlich mit
seiner Arbeit, seinem Dienst, mithin auch mit seinem öffentlichen Arbeitgeber
Er drückt das aus in einem sichtbaren Berufsstolz und der Bereitschaft
zu einer hohen Loyalität als öffentlich-rechtlich Angestellter. Er arbeitet
in einer Solidargemeinschaft für die Allgemeinheit.
Die
Entwicklung des service public kann nie stehen bleiben. Es müsste eine
Herausforderung sondergleichen sein für die Manager der service public-Unternehmer,
die nötigen und sinnvollen Erneuerungen in engster Tuchfühlung mit dem
Eigentümer-Volk und mit den Angestellten des service public zu erarbeiten
und umzusetzen.
In diesem Bereich könnten Exempel von citoyen-würdiger Wirtschaftsdemokratie
erprobt und gelebt werden.
|