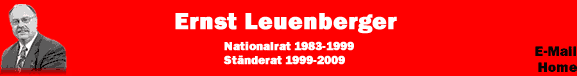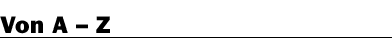
Ständerat: Herbstsession, 24. September 2002
Sonntagsinitiative
Ganze
Debatte zu diesem Geschäft
Leuenberger Ernst (S, SO), für die Kommission: In der Tat treffen
wir hier eine alte Bekannte an, die Sonntags-Initiative beziehungsweise
den parlamentarischen Versuch, einen indirekten Gegenvorschlag zu dieser
Volksinitiative auf Gesetzesebene auszuarbeiten. Der Nationalrat hat
schon sehr früh einen Gegenvorschlag vorgelegt, den Sie auch auf
der heutigen Fahne finden. Unser Rat hat in einer ersten Runde das Eintreten
auf einen Gegenvorschlag abgelehnt; erst in der Differenzbereinigung
hat dann auch unser Rat am vergangenen 11. März mit knapper Mehrheit
Eintreten beschlossen.
Dieses Eintreten auf einen Gegenvorschlag bedeutete, dass die Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen den Auftrag erhielt, den Gegenvorschlag
des Nationalrates zu prüfen und eventuell einen eigenen vorzulegen.
Das tut Ihre Kommission nun. Sie hat sich dabei auf die loyale Mitarbeit
des Astra stützen können, trotz materieller Bedenken, die
dort und bekanntlich auch beim Bundesrat vorhanden sind.
Der Gegenvorschlag unserer Kommission liegt nun vor; ich will ihn sogleich
in drei Abschnitten erläutern. Ich darf zu Beginn noch darauf hinweisen,
dass die Fahne in einem wichtigen Detail hat korrigiert werden müssen:
Es liegt ein Minderheitsantrag für die Gesamtabstimmung vor. Dort
ist irrtümlicherweise als Mitunterzeichner Herr Lombardi aufgeführt.
Herr Lombardi gehört aber nicht zur Minderheit. Anstelle des Namens
Lombardi ist auf dieser Fahne der Name Lauri zu setzen.
Wenn Sie erlauben, werde ich gleich mit Ziffer I beginnen und erklären,
was wir da erfunden haben. Sie haben sofort festgestellt, dass Artikel
2 Absatz 2 des geltenden Rechtes, des heutigen Strassenverkehrsgesetzes,
dem Bundesrat die Kompetenz gibt, Fahrverbote zu erlassen, namentlich
Nacht- und Sonntagsfahrverbote. Im neu vorgesehenen Artikel 2 Absatz
2bis wird ein Fahrverbot an Sonntagen für Motorfahrzeuge stipuliert.
Die Kommission möchte mit Ihrem Entwurf dem Bundesrat die Kompetenz
geben, den Sonntag selber zu bestimmen, nachdem es sich erwiesen hat,
dass wir hier im Parlament grosse Mühe bekundet haben, uns auf
einen bestimmten Sonntag einigen zu können. Das ist der erste Punkt
dieses Gegenvorschlags.
Der zweite Punkt des Gegenvorschlags ist das Fahrverbot an diesen bestimmten
Sonntagen von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie beachten, dass der Nationalrat
eine viel längere Tagesdauer festgelegt hat, von 05.00 Uhr bis
22.00 Uhr. Die ständerätliche Kommission hat aus praktischen
Gründen eine kürzere Geltungsdauer genommen. Es wurde namentlich
aus Tourismusgebieten argumentiert, dass mit einem Schluss des Fahrverbots
um 20.00 Uhr Leuten an einem Sonntagabend noch ermöglicht wird,
aus einem Tourismusgebiet nach Hause zurückzukehren.
Der dritte Punkt betrifft die Ausnahmen von diesem Fahrverbot. Da gibt
es eigentlich im ersten Teil keine Differenz zum Nationalrat. Die Ausnahme
soll für den öffentlichen Verkehr und auch für berufsmässige
Fahrten mit Gesellschaftswagen gelten. Die ständerätliche
Kommission hat neu die weitere Ausnahme hinzugefügt, dass sich
auch stark mobilitätsbehinderte Menschen mit Motorfahrzeugen bewegen
sollen können.
Im Weiteren wird im vierten Punkt des Absatzes 2bis(neu) wie auch beim
Nationalrat festgehalten, dass der Bundesrat die Kompetenz hat, weitere
Ausnahmen zu bestimmen.
In einem fünften Punkt wird der Bundesrat bevollmächtigt,
den Verkehr mit dem Ausland zu regeln. Diese Bestimmung ist eigentlich
überflüssig, sie wird hier aber der Vollständigkeit halber
erwähnt. Es versteht sich von selbst, dass der Bundesrat und seine
Verwaltung mit dieser Aufgabe betraut sind.
Wir haben sodann in einer Ziffer II in diesem ständerätlichen
Entwurf für einen Gegenvorschlag die Frage geregelt, was geschehen
soll, wenn dieser Versuch - es ist ein Versuch, der auf vier Jahre angelegt
ist - ausläuft. Da ist in der nationalrätlichen Fassung und
auch im ständerätlichen Kommissionsentwurf festgehalten, dass
im vierten Jahr der Gültigkeit dieses Beschlusses die Bundesversammlung
dazu Stellung nehmen soll, ob dieser Versuch definitiv zu machen oder
abzubrechen ist. Das ist also eine Verpflichtung, die der Gesetzgeber
im vierten Gültigkeitsjahr sich selber auferlegt. Er wird die Sache
erneut prüfen und dann Beschluss fassen.
In Ziffer III, die die Übergangs- und Schlussbestimmungen enthält,
gibt es eigentlich nur eine redaktionelle Änderung über die
Gültigkeit dieses zu fassenden Beschlusses.
Ich habe Sie am Schluss meiner einleitenden Ausführungen darauf
aufmerksam zu machen, dass wir jetzt in die Detailberatung eintreten
werden, und ich bitte Sie, dem Kommissionsentwurf in der Detailberatung
zu folgen. Ich habe Ihnen sodann mitzuteilen, was Sie der Fahne bereits
entnommen haben, dass nämlich eine Kommissionsminderheit mit der
grösstmöglichen Stärke, mit der eine Minderheit antreten
kann, Ihnen am Schluss beantragen wird, die heute beratene Vorlage in
der Gesamtabstimmung zu verwerfen. Dieser Entscheid ist, das sei zugegeben,
nur mit dem Stichentscheid des Kommissionspräsidenten zustande
gekommen, und das zeigt Ihnen allen, dass wir uns in relativ knappen
Verhältnissen befinden. Aber heute Morgen sind die Zeitungen voll
davon, sie sagen, knappe Mehrheitsverhältnisse disziplinieren.
Wir werden sehen, ob dieses Modell auch in der Schweiz spielt.
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass nach dem geltenden Parlamentsrecht
- sollte heute der Ständerat in der Gesamtabstimmung zu diesem
Gegenvorschlag Nein sagen - der Gegenvorschlag von der Geschäftsliste
des Parlamentes gestrichen ist. Weshalb ist das so? Eine Ablehnung dieser
Vorlage in der Gesamtabstimmung würde qualifiziert wie ein Nichteintreten,
und dieser Rat, der Ständerat, ist in einer ersten Runde auf den
Gegenvorschlag nicht eingetreten. Jetzt haben wir sozusagen parlamentsrechtlich
die zweite Runde. Sollten wir diesen Beschluss fassen, der einem Nichteintretensantrag
gleicht, dann wäre bei zweimaligem Hin und Her bei Eintretensdifferenzen
dieses Geschäft tatsächlich von der Geschäftsliste gestrichen.
Das bringt mich dazu, mir zu erlauben, Sie namens dieser knappest möglichen
Mehrheit noch einmal zu bitten, sich noch einmal zu überlegen,
was ein Gegenvorschlag denn eigentlich grundsätzlich soll. Ein
Gegenvorschlag meint immer, dass man findet, das Kernanliegen einer
Initiative habe etwas Richtiges, habe etwas für sich, habe etwas
Unterstützungswürdiges. Man geht dann hin, macht einen Gegenvorschlag
und zieht einer Initiative die gröbsten Zähne oder - um im
Hühnerhofjargon zu reden - rupft das Huhn so weit, bis es nur noch
neuen ästhetischen Gesichtspunkten genügt; offenbar können
auch gerupfte Hühner eine gewisse Ästhetik entwickeln, die
mir zwar fremd geblieben ist, aber das ist vermutlich mein Problem.
Ich finde, wir haben in dieser Kammer Volksinitiativen immer sehr ernst
genommen. Ich bitte Sie, das auch heute zu tun. In diesem Sinne bitte
ich Sie, die Detailberatung an die Hand zu nehmen, den Kommissionsanträgen
zu folgen und in der Gesamtabstimmung dem beratenen Entwurf zuzustimmen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ernst Leuenberger SO für die Kommission: Als ob es 1973 nie gegeben
hätte! Wir alle, die wir in diesem Saal sitzen, haben 1973 erlebt,
als der Bundesrat in schwieriger Zeit, um Erdöl zu sparen, just
das gemacht hat, was jetzt einzelne Mitglieder dieses Rates hier als
undurchführbar und unmöglich bezeichnen. Offenbar waren die
Behörden der Eidgenossenschaft 1973 in schwieriger Zeit klüger
als wir heute alle zusammengerechnet. Die Geschichte ist praktikabel,
1973 beweist es. Gehen Sie bitte in die Archive und schauen Sie nach,
wie man das damals gemacht hat. Oder wenn Sie mal neben dem Autofahren
einen Augenblick der Besinnlichkeit finden, versuchen Sie sich ganz
persönlich daran zu erinnern, wie Sie das damals erlebt haben.
Das ist vielleicht für einen Kommissionssprecher etwas polemisch,
aber Sie haben bei der Beschreibung der praktischen Probleme ordentlich
dick aufgetragen.
Ich möchte noch versuchen, eine sehr ernsthafte Geschichte etwas
anders zu beleuchten: Die Initiative muss unbedingt dem Volk vorgelegt
werden. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen,
dass alle Volksinitiativen, die ich kenne, eine Rückzugsklausel
und ein bezeichnetes Gremium enthalten, das das Recht hat, die Initiative
zurückzuziehen. Weshalb? Die Initiative hat nie den ersten Zweck,
eine Volksabstimmung zu provozieren. Jede Initiative, und das haben
die Politologen uns gezeigt, hat die Absicht, anregend zu wirken, eine
Frage auf die politische Agenda zu setzen, die möglicherweise ohne
dieses Mittel der Initiative sonst nicht auf die politische Agenda käme.
Die Initiantinnen und Initianten lassen sich mit dem Mittel der Rückzugsklausel
immer eine Türe offen: Falls es auf einfacherem Wege statt über
den Weg einer Volksabstimmung geht, dann sind sie bereit, Initiativen
zurückzuziehen. Ich würde nicht so weit gehen, das Ringen
um den Rückzug einer Initiative als Kuhhandel zu bezeichnen.
Jene von Ihnen, die schon in Initiativkomitees sassen, wissen, dass
es durchaus legitim ist, dass man entweder zur Regierung oder zum Parlament
geht und sagt: Wenn du, Parlament, mir auf dem Gesetzeswege entgegenkommst,
dann ziehe ich meine Initiative zurück. Das hat im Übrigen
auch einen ganz praktisch-politischen Grund: Immerhin wissen wir, dass
seit Einführung des Initiativrechtes nur wenige Volksinitiativen
tatsächlich angenommen worden sind. Das hat aber noch niemanden
dazu bewogen, das Initiativrecht abschaffen zu wollen, weil man bei
näherer Beobachtung und Betrachtung eben feststellen kann, dass
die Initiative ein Anregungsmittel ist.
Mein grosser Lehrer in politischen Wissenschaften, Erich Gruner, hat
uns einmal gesagt, das Mittel der Initiative führe immer wieder
dazu, dass politische Kreise, die nicht parteipolitisch oder verbandsmässig
strukturiert sind, ihre Anliegen mit diesem Mittel in die politische
Beratung einbringen könnten. Das sei - führte er aus - ein
Integrationsmittel sondergleichen.
Wenn ich die Initiantinnen und Initianten der Sonntags-Initiative, die
zum grossen Teil junge bis sehr junge Leute sind, höre und ihre
Begeisterung für ihr Projekt sehe, muss ich Ihnen nochmals sagen:
Es würde sich auch demokratiepolitisch lohnen, ihnen in Form dieses
Gegenvorschlages etwas zu offerieren.
Ich bitte Sie, der sehr knappen Kommissionsmehrheit zuzustimmen und
diese Vorlage anzunehmen.
Zurück zur Übersicht
|
|
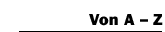 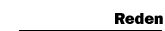  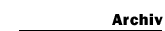 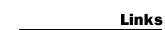 |