|
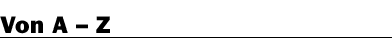
Referat zum 1. Mai 2001 in Rapperswil/SG
Ständerat
Ernst Leuenberger, Präsident SEV, Solothurn
Es gilt
das gesprochene Wort!
Der Grundgedanke
der Maifeierbewegung hat auch nach über 100 Jahren seine Gültigkeit
nicht verloren und das erst recht unter Bedingungen einer zunehmend
globalisierten Wirtschaft: Sozial Schwächere können ihre Rechte nur
erkämpfen, wenn sie sich international zusammenschliessen. Solidarisches
Verhalten ist gefragt über alle Grenzen von Staaten, Sprachen, Religionen,
Rassen und Kontinenten hinweg.
Am Internationalen
Arbeiterkongress von 1889 in Paris ging es darum, die heillos zerstrittene
internationale Arbeiterbewegung hinter mindestens einer einheitlichen
Forderung zusammenzubringen. Man schrieb die Erkämpfung des 8-Stunden-Tages
auf die Transparente und einigte sich darauf, inskünftig jährlich am
1. Mai für diese Forderung in allen Ländern zu demonstrieren.
Wichtig
war und ist die Erkenntnis, dass diese Forderung nur eine Chance haben
konnte, wenn sie weltweit erhoben und durchgesetzt wird. Das Argument
der Gegenseite, die Konkurrenzfähigkeit werde bei der Gewährung von
Arbeitszeitverkürzungen nur in einem Land dort massiv beeinträchtigt
entfiele damit automatisch.
So steht
denn seit jenen Tagen der Gedanke der internationalen Solidarität im
Zentrum aller sozialen Bewegungen, die sich zur Maifeierbewegung zählen.
Solidarität üben ist schwierig. Solidarität ist nur dann etwas wert,
wenn sie auch etwas kostet. Das braucht nicht unbedingt Geld zu bedeuten.
Es kann auch eine Anstrengung sein, anderen beizustehen, andere zu akzeptieren.
Schritte unternehmen zu andern, zu Unbekannten, zu Fremden. Das alles
gehört dazu.
Solidarität
üben heisst damit schlicht und einfach teilen, teilen lernen.
Wir alle
wissen aus unseren Kindheitstagen, auch aus unserer Erziehungsarbeit
als Eltern oder Grosseltern, wie schwierig es ist, teilen zu lernen.
Aber wir wissen auch, wie wichtig es ist zu teilen. Schwieriges Teilen
bei einer Gegenmentalität: "Selber essen macht fett", " Wenn jeder für
sich selber schaut, ist für alle gesorgt."
- Wir
können Arbeit teilen. Arbeit kann besser verteilt werden. Arbeit
und damit Erwerbseinkommen können besser, gerechter aufgeteilt werden
auf alle Köpfe und Hände. Dieses Prinzip verficht auch eine Initiative
des Schweiz. Gewerkschaftsbundes, in welcher die 36 Std-Woche gefordert
wird.
- Einkommen
kann geteilt werden mit Einkommenslosen. Das kann auch heissen,
dass ich Sozialversicherungsprämien bezahle, damit eine anständige
Arbeitslosenversicherung möglich wird für die Betroffenen.
- Es
kann auch heissen, dass ich bereit bin, das Stimmrecht zu teilen,
mit denjenigen, die kein Stimmrecht haben.
Das
heisst auch, sauberes Wasser und saubere Luft, ja ein Stück intakter
Natur teilen mit unseren Nachfahren, auch den noch Ungeborenen.
Solidarität
heisst auch Kampf gegen jegliche Diskriminierung. Das muss heissen,
dass ich nicht zulasse, dass in meiner Umgebung diskriminiert und unterdrückt
wird. Das muss heissen, Zivilcourage zu haben und einzuschreiten. Unsere
Solidarität hat all jenen zu gelten, die unterdrückt und verfolgt werden.
Unsere Solidarität gilt weltweit denjenigen, die heute nicht wissen,
was sie morgen ihren Kindern zu essen geben sollen. Unsere Solidarität
gilt denjenigen, die ? auch bei uns, hier und jetzt ?bedrückt und verzagt
sind und keine Zukunft vor sich sehen.
Wer von
Solidarität spricht, muss jenen politischen Kräften die Stirne bieten,
die nichts als Egoismus, Eigennutz und Ausgrenzung anderer im Sinne
haben. Wenn auch in der Schweiz die äussere Rechte Wahlerfolge feiert,
die auf der Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger beruhen, nachdem
man zuerst durch Angstmacherei die Leute verunsichert hat, ist dieser
Zustand alarmierend und verlangt entschieden Gegensteuer.
Die Gewerkschaften,
die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter; die politischen Parteien
im rot-grünen Bereich, mit echt liberalen bürgerlichen Kräften müssen
heute entschieden aufstehen gegen den Rechtspopulismus der professionellen
Vereinfacher.
Wer mit
Fremdenfeindlichkeit Stimmung macht und so Wahlen gewinnt, spielt mit
dem Feuer. Wir sind als Feuerwehr gefragt, wir alle. Und noch eines:
Wenn vereinzelte Strategen der bürgerlichen Mitte meinen, durch Nachgiebigkeit
könne man diesen Kreise Meister werden, täuschen sie sich gewaltig.
Nur eine klare Haltung bewahrt die Grundlagen des eidgenössischen Zusammenlebens,
die da heissen: sozialer Ausgleich, friedliches Zusammenleben der Sprach-und
Kulturgemeinschaften.
In
der Sozialpolitik bedeutet Stillstand Rückschritt.
Grosse
Auseinandersetzungen stehen bevor: in den nächsten Tagen wird der Nationalrat
mit der Beratung der 11. AHV-Revision beginnen. Wir erinnern uns: bei
der 11. Revision sollte die Finanzierung der AHV längerfristig geregelt
werden. Das ist nötig, weil wir Menschen (glücklicherweise) immer älter
werden. Die Frage des flexiblen Rentenalters sollte gelöst werden. So
haben die Versprechungen stets gelautet.
Die bundesrätliche
Vorlage kam als Schocktherapie daher: weitgehende Abschaffung der Witwenrente
aus reinen Spargründen.
Der Nationalrat
muss nun diese Scharte auswetzen, sonst ist die Vorlage extrem referendumsbedroht.
In der
11. AHV-Revision wird es sich definitiv zeigen, ob die Bürgerlichen
sich dazu versteigen, ihre brutalen Sozialabbaupläne durchzustieren.
Was bürgerliche
Politik wirklich will, wird uns in diesen Tagen und Wochen vordemonstriert:
Sparen beim Sozialstaat, ja Sozialabbau. Sparen in der Bildung, Sparen
bei der Infrastruktur (das sind auf deutsch Bahn, Post, etc) Dafür Steuersenkungen
für die Reichen.
Damit wären
wir bei Finanz und Finanzierungspolitik.
Einige
bürgerlichen Batzenklemmer wollen einen armen Staat, einen schlanken
Staat, sie wollen wieder den uralten Nachtwächterstaat.
Natürlich
weiss ich, dass das ganze Volk will, das seine öffentlichen Hände sparen.
Indessen gibt es bürgerliche Sparapostel, die vor allem ihre reiche
Klientel schonen wollen vor Steuern und Abgaben und auf diesem Wege
sogar die Demontage des Sozialstaates in Kauf nehmen. Sie nehmen das
Kappen des regionalen Ausgleichs in Kauf. Regionaler Ausgleich, der
neben dem sozialen Ausgleich recht eigentlich die Schweiz ausmacht.
In unserem Land wurden Projekte verwirklicht, die den Vergleich mit
dem Ausland nicht zu scheuen brauchen. Ich denke dabei in erster Linie
das leistungsfähige Bildungssystem und das nahezu flächendeckende Angebot
des öffentlichen Verkehrs. Alle diese Errungenschaften waren nur durch
die Solidarität zwischen arm und reich, jung und alt und Stadt und Land
überhaupt möglich und sind unsere wertvollsten Standortfaktoren in der
globalisierten Wirtschaft.
Es ist
uns in letzter Zeit aufgefallen, dass "sozialer Ausgleich" zwischen
oben und unten nicht mehr Mode ist. Ich beschreibe das am Beispiel der
Löhne in den dem Bund gehörenden Betrieben.
Es galt
jahrzehntelang als hehres Prinzip, dass der Bund ganz oben schlechter
bezahlt als die Privatwirtschaft (und er fand meistens sehr gute Chefs
für Verwaltung und Betriebe) und es galt ferner, dass der Bund und seine
Betriebe unten in der Hierarchie etwas besser bezahlten als die Privaten.
Darauf war man im Schweizerland stolz und pries das als Muster und nannte
das ganze "Sozialer Augleich".
Nun kommen
kluge Verwaltungsratspräsidenten zu den Bundesbetrieben und verfügen
Marktlöhne. Das heisst: zuerst explodieren die Managerlöhne bei Swisscom,
Post und Bahn. Ganz nebenbei bedienen sich die Verwaltungsratspräsidenten
auch noch ganz unbescheiden z.B. mit einem Tageshonorar von Fr. 2500.-
. Kurz darauf werden die gleichen "Grosskopfete" daherkommen und die
unteren Löhne kürzen wollen, weil sie über den Marktlöhnen lägen. So
stellen sich diese Herrschaften das vor. Wenn der Bundesrat diesem zerstörerischen
Spiel noch lange tatenlos zusehen will, wird ihm das Parlament "Beine
machen müssen".
Aus diesen
Fakten ziehe ich einen klaren Schluss:
Dieses
Schweizerland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land
brauchen Gewerkschaften, mehr Gewerkschaften, überall Gewerkschaften.
Gewerkschaften auch in den "neuen" Branchen.
Der Gedanke
der gewerkschaftlichen Organisation muss von und und durch uns noch
mehr verbreitet werden. Es sei nicht modern, organisiert zu sein. So
vekündet es der neoliberale Zeitgeist und seine Hohepriester. Jeder
sei seines eigenen Glückes Schmied. Einigen wenigen mag das gelingen,
wenn sie rücksichtslos genug vorgehen.
Der Maifeierbewegung
geht die Arbeit nicht aus. Die hohen Ziele "internationale Solidarität"
und Schaffung sozialer Gerechtigkeit hier im Lande und weltweit erfordert
unser aller Einsatz.
Dieser
1.Mai 2000 ist uns Anlass, unser Versprechen, den Zielen der Maifeierbewegung
zu dienen mit freudigem Einsatz zu erneuern und zu bekräftigen.
|