|
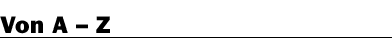
Ständerat:
Frühjahrssession 2005:
Ausländergesetz.
«Während
in den 70er-Jahren ein Aussenseiter, der etwas verschrobene Textilindustriellen-Spross
Schwarzenbach, diese Fremdenfeindlichkeit mit soit disant konservativen
Argumenten gepflegt hat und durch die ganz grosse Koalition aller Bundesratsparteien,
aller verantwortungs
bewussten Wirtschaftsverbände damals im Juni 1970 hat abgewehrt
werden können, haben sich die Verhältnisse geändert,
als der damalige Besitzer der Emser Werke sich in diese Konjunktur eingeschaltet
und begriffen hat, dass Fremdenfeindlichkeit politisch ein Top-Erfolgsrezept
ist, mit dem man gross Politik machen kann (…).»
16.03.05.
Leuenberger Ernst (S, SO): Ausländerpolitik im Sinne dieses Gesetzes
ist zu weiten Teilen auch Arbeitsmarktpolitik. Das ist in Rechnung zu
stellen. Arbeitsmarktpolitik heisst auch: Es geht um handfeste ökonomische
Interessen. Ich bin seit über 30 Jahren Gewerkschaftssekretär.
Ich habe immer wieder erlebt, dass bei jedem Konjunkturaufschwung die
Unternehmenden den Arbeitsmarktbehörden praktisch die Türe
eingedrückt und mehr ausländische Arbeitskräfte verlangt
haben. Die Gewerkschaften hatten mit den Jahren in einzelnen Kantonen
erreicht, dass sie bei der Erteilung dieser Bewilligungen ein Mitspracherecht
haben, bei der Kontrolle der gemachten Auflagen, die dazu führen
sollten, dass über dieses Stück Arbeitsmarktpolitik nicht
splitternackte Sozialdumpingpolitik betrieben wird. Das ist über
Jahrzehnte einigermassen gelungen, und zwar deshalb, weil die wesentlichen
politischen Kräfte dieses Landes sowie sämtliche verantwortungsbewussten
Wirtschaftsverbände sich immer wieder bemüht haben, in dieser
Ausländerpolitik, Teil Arbeitsmarktpolitik, einen Konsens zu finden
und Angriffe auf diese Politik eben gemeinsam abzuwehren. Das hat sich
inzwischen grundlegend geändert. Wir haben schon in den 70er-Jahren
feststellen müssen, dass einzelne dieser Unternehmen, die zuerst
hingegangen sind und Bewilligungen für ausländische Arbeitskräfte
verlangt und auch erhalten haben, nach Hause gegangen sind und einen
Einzahlungsschein ausgefüllt haben für einen Beitrag an die
nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat, die
dann in simple und primitive Fremdenhetze ausgebrochen ist. Damit bin
ich beim Hintergrund all dieser Diskussionen, die wir heute und morgen
führen. Es ist vermutlich an der Zeit, auch in diesem Zusammenhang
Klartext zu reden.
Während in den 70er-Jahren ein Aussenseiter, der etwas verschrobene
Textilindustriellenspross Schwarzenbach, diese Fremdenfeindlichkeit
mit soit disant konservativen Argumenten gepflegt hat und durch die
ganz grosse Koalition aller Bundesratsparteien, aller verantwortungsbewussten
Wirtschaftsverbände damals im Juni 1970 hat abgewehrt werden können,
haben sich die Verhältnisse geändert, als der damalige Besitzer
der Emser Werke sich in diese Konjunktur eingeschaltet und begriffen
hat, dass Fremdenfeindlichkeit politisch ein Top-Erfolgsrezept ist,
mit dem man gross Politik machen kann, und dazu geführt hat, dass
diese grosse Koalition, die die vernünftigten Lösungen in
der Ausländerpolitik während Jahrzehnten getragen hat, dann
auseinandergebrochen ist.
Vor diesem Hintergrund einer äusserst primitiven und finanzkräftig
geförderten Fremdenhetze von politischen Konjunkturrittern müssen
wir heute und morgen schwierige und schwierigste Fragen in diesem Zusammenhang
diskutieren.
Ich habe grossen Wert darauf gelegt, das hier auszusprechen. Es werden
dann einzelne Journalisten sagen, ich hätte jetzt provoziert und
durch diese Provokation sei das Gesetz noch schärfer ausgefallen,
als es eigentlich geplant war. Als Anhänger der Aufklärung
vertraue ich darauf, dass man mir hier in dieser Chambre de réflexion
zwar ordentlich heimleuchtet, das gehört zur Diskussion und zum
Diskurs; aber ich vertraue auch darauf, dass kein einziges Mitglied
dieser zweiten Kammer des eidgenössischen Parlamentes nur aus einer
Trotzreaktion in eine bestimmte Richtung stimmt.
Ziel dieser Revision muss es sein, klar zu machen - soweit es um Arbeitsmarktpolitik
geht -, dass Dumping verhindert werden muss; es müssen jenen, die
Bewilligungen erhalten, Auflagen gemacht werden; es müssen bezüglich
der Integrationsanstrengungen dieser ausländischen Bevölkerungsteile,
die als Arbeitende in die Schweiz kommen, Auflagen gemacht werden; es
müssen Schutzvorschriften erlassen, durchgesetzt und gefördert
werden, die jeglichen Verdacht von uns nehmen, dass über diese
Bewilligungspolitik letztlich Sozialdumping angestrebt wird.
Wenn es, wie ein Vorredner deutlich ausgeführt hat, unser Ziel
sein soll, im Herbst der Personenfreizügigkeit zum Durchbruch zu
verhelfen, damit wir wieder Verhältnisse erhalten, wie wir sie
am Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts gekannt
haben, müssen wir hier einige Pflöcke einschlagen, die klar
machen: Wir wollen über diese ganze Bewilligungspolitik klare Verhältnisse
schaffen, Auflagen erlassen und Auflagen auch durchsetzen. Diese Überlegungen
waren für mich der Grund, auf diese Gesetzesrevision einzutreten.
Was dann in der Kommission herausgekommen ist, hat mich eigentlich in
der Meinung bestärkt, dass wir mit dieser Art Gesetzgebung dieses
gesteckte Ziel nicht erreichen. Man soll die Hoffnung nie aufgeben -
wir werden sehen, wie das weitergeht.
Das
ganze Geschäft
|
|
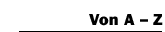 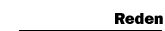  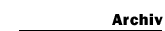 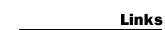 |