|
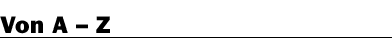
Wintersession
2004. 04. Sitzung / 02.12.04-08h00
Personenfreizügigkeit.
Flankierende Massnahmen
Ernst Leuenberger
erwartet eine Volksabstimmung. Sie im Sinne der Personenfreizügigkeit
zu gewinnen, erfordert dringend die Verbesserung der Sicherungen gegen
Lohn- und Sozialdumping und zwar nach den Grundsätzen der Branchenüblichkeit.
Leuenberger
Ernst (S, SO): Ich will es vorwegnehmen, ich trete ein, selbstverständlich
mit dem Vorbehalt: Abgerechnet wird am Schluss, wie wir das ja zum Brauch
haben. Vielleicht erlaubt mir Herr Schmid, dass ich auf seinen Vorwurf
an die Linke hin, sie hätte den Internationalismus über Bord
geworfen, etwas spöttisch festhalte: Nachdem die Rechte die Linken
hundert Jahre lang wegen ihres Internationalismus als vaterlandslose
Gesellen geprügelt hat, könnte es ja sein, dass dieser Internationalismus
der Linken inzwischen abhanden gekommen ist.
Aber nun seriös: Ich gehe davon aus, dass die Vorlage, die hier
zur Debatte steht, letztendlich eine Volksabstimmung zu bestehen hat.
Referenden sind von verschiedenen Seiten angekündigt. Ich nehme
an, irgendwer wird am Schluss das Referendum ergreifen. Darum ist unsere
ganze Debatte hier und heute halt trotz allem ein Vorgefecht auf die
kommende Volksabstimmung, und ich möchte vor meinen Leuten dann
dafür geradestehen können, dass wir in diesem Zusammenhang
wirklich - wie das Herr David schon bei einer anderen Vorlage gesagt
hat - alle Ecken ausgeleuchtet haben.
Ich versuche, Ihnen schnell drei Bilder zu zeigen, die sich mir bei
meinen Wanderpredigten im ganzen Land präsentieren:
Das erste hat mit der Hochpreisinsel Schweiz zu tun. Dieser Hochpreisinsel
Schweiz, sagen alle, sei zu Leibe zu rücken. Es gibt Leute, die
sagen: Ja, das kann man ganz einfach machen; man öffnet den schweizerischen
Arbeitsmarkt beliebig, dann sind Arbeitskräfte im Überfluss
vorhanden, und das wird dann seine Wirkung am Arbeitsmarkt haben: auf
die Arbeitsentgelte, auf die Löhne - die werden sinken, die Arbeitnehmereinkommen
werden sinken -; und damit ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Hochpreisinsel
Schweiz geleistet. Ich halte das für ein gefährliches Bild,
für ein Bild, das ich mir selbstverständlich nicht wünsche.
Aber wir haben den Beweis hier und heute gesetzgeberisch anzutreten,
dass wir der Hochpreisinsel Schweiz nicht auf diese Weise zu Leibe rücken
wollen.
Das zweite Bild hat mit jener Phase nach der Ablehnung des EWR-Beitritts
zu tun, als man den bilateralen Weg zu begehen begann. Am Anfang standen
immer feierliche Erklärungen - und dies wurde durchgezogen -, es
sei, auf jeden Fall im Zusammenhang, der mich jetzt speziell interessiert,
allgemeines Lohn- und Sozialdumping zu verhindern, auch unter der Bedingung
von Personenfreizügigkeit.
Es ist immer eingeräumt worden, dass es eine schwierige Geschichte
ist, ökonomische Grundgesetze von Angebot und Nachfrage bei ebendiesem
geöffneten Arbeitsmarkt dann mit Kontrollen tatsächlich in
den Griff zu bekommen. Wer das bestreitet, würde den Leuten Sand
in die Augen streuen.
Es ist wahr, und es wurde gesagt: Die reale Einführung dieser Personenfreizügigkeitsschritte
ist jung, und die Erfahrungen damit sind ebenfalls jung. Es ist auch
eingestanden worden, dass zum Teil das Erschrecken über die Auswirkungen
in Einzelfällen - ich will diese Vorkommnisse vorläufig noch
als Einzelfälle gelten lassen - gross ist. Selbstverständlich
sind nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erschrocken; Frau
Forster hat ausgeführt, dass auch Gewerbekreise erschrocken sind,
weil Gewerbekreise, wie z. B. die Baubranche mit ihrem allgemein verbindlich
erklärten Landesmantelvertrag, ja im Allgemeinen auch davon leben,
dass eben nicht zu beliebigen Bedingungen offeriert und gearbeitet werden
kann; dort hat man eben geordnete Verhältnisse. Ich bin auch erschrocken,
als die kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren etwa vor drei Wochen,
als sich die medialen Reklamationen häuften, etwas lapidar mitteilten,
diese Kontrollen könnten sie in den Kantonen gar nicht machen,
da sollten die Sozialpartner schauen. Das ist ein gefährlicher
Satz, und ich habe das allen Volkswirtschaftsdirektoren deutlich gemacht,
die ich inzwischen getroffen habe. Ich glaube zu wissen, dass auch der
Wirtschaftsminister, Bundespräsident Deiss, entsprechend mit den
Volkswirtschaftsdirektoren gesprochen hat.
Bund und Kantone haben da vermutlich nicht alle Hausaufgaben gemacht.
Es bestehen noch erhebliche Probleme. Wie ich schon ausgeführt
habe, rechne ich mit einer Volksabstimmung, auch wenn ich selber im
Moment nicht die Absicht habe, in ein Referendumskomitee zu sitzen;
deshalb muss ich Ihnen sagen: Wir müssen subito danach trachten,
dass diesen Einzelfällen der Boden entzogen wird. Und das ist eine
gewaltige Aufgabe für die Sozialpartner, die kantonalen und die
eidgenössischen Behörden. Ich mahne dringend, das sehr, sehr
ernst zu nehmen.
Nachdem ich nun mehrmals von einem Referendum gesprochen habe, lege
ich Wert auf die Feststellung, dass ich hier keine Referendumsdrohungen
ausstosse; das ist eigentlich nicht meine Art. Aber ich glaube gelesen
zu haben, dass Kreise, denen ich das Attribut Fremdenfeindlichkeit gerne
zuordne, bereits von einem Referendum in diesem Zusammenhang gesprochen
haben.
Ich nehme an, dass die das auch tatsächlich machen werden, und
es wäre fatal, wenn wir ihnen leichtes Spiel machten, indem sich
eben die Fälle häuften, wo man nachweisen kann, dass die Ausländer,
die eben aus dem Ausland stammen - das haben Ausländer so an sich
-, in diesem Land dann als Dumper auftreten. Als langjähriger Gewerkschaftsfunktionär
sage ich Ihnen: Gegen diese propagandistische Dummheit kämpfen
selbst Götter vergebens, geschweige denn Gewerkschaftssekretäre,
Politikerinnen oder Bundesräte. Da haben wir kein Brot. Wenn die
Leute einmal glauben, da würden unterschwellig, torpedobootähnlich,
Leute eingeschleust, die bereit seien, zu allen Bedingungen zu arbeiten,
dann haben wir die Geschichte verloren, bevor wir richtig damit begonnen
haben. Und den grossen Teilnehmern an den aktuellen Islam-Debatten kann
ich nur sagen: Eine gewisse Zurückhaltung - christliche Zurückhaltung
auch - könnte sich durchaus empfehlen.
Ein drittes Bild muss ich Ihnen zeichnen, und Sie werden mir dann vermutlich
sagen, das sei ein bisschen weit hergeholt und habe unmittelbar mit
den Vorlagen nichts zu tun. Der Bund ist auch sonst noch gefordert,
abgesehen von diesen Kontrollen. Im weiteren EU-Zusammenhang sind nämlich
in den mittleren Neunzigerjahren grosse Reformen bei den damaligen Bundesbetrieben
an die Hand genommen worden - EU-Veranlassung, EU-Richtlinien, die können
wir alle auswendig -, die da haben umgesetzt werden müssen, und
ich lege Wert darauf zu erwähnen, dass wir alle damals wesentliche
Massnahmen mitgetragen haben. Wir haben entschieden, dass die Post,
die Bahn und die ehemalige Telecom PTT in den Wettbewerb zu schicken
seien. Wir haben das aus EU-Gründen gemacht; ich habe es schon
gesagt. Die EU-Gegner waren enthusiastisch für diese Liberalisierung,
die EU-Befürworter eher ein bisschen zögerlich, aber allesamt
haben wir diese Geschichte gemeinsam veranstaltet.
Und es stellten sich nun auch hier bei diesem Wettbewerb Dumpingfragen,
und das will ich hier und heute vom Bundesrat wissen: Der Bundesrat
hat am Klaustag des Jahres 1999 etwas getan, wofür ich ihm den
goldenen Gartenzwerg überreichen möchte, er hat nämlich
in einer Motionsbeantwortung dazu Stellung genommen, wie Lohn- und Sozialdumping
bei dieser ganzen Reform zu vermeiden seien. Ich zitiere, es geht um
die Motion 99.3486. Am 6. Dezember 1999 antwortet der Bundesrat: "Die
Verhinderung eines allgemeinen Lohn- und Sozialdumpings ist ein zentrales
Anliegen bei der Umstrukturierung der Bundesbetriebe. Nur so können
wesentliche Ziele unserer Wirtschaftspolitik .... erreicht werden. Bei
der Liberalisierung der Märkte im Bahn- und Fernmeldebereich war
sich der Gesetzgeber der Gefahr eines Sozialdumpings bewusst."
Aus diesem Grund hat das Parlament Vorschriften eingeführt, wonach
nicht nur arbeitsrechtliche Vorschriften einzuhalten seien, sondern
auch die Gewährleistung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen.
Der Bundesrat in seiner Weisheit hat sogar noch gesagt, was branchenübliche
Arbeitsbedingungen in diesem Zusammenhang sind: "Deshalb werden
die Gesamtarbeitsverträge von Post, Swisscom und SBB bei der Beurteilung
der branchenüblichen Arbeitsbedingungen einen wesentlichen Massstab
darstellen."
Hohes Lob an den Bundesrat für seine Erklärung von 6. Dezember
1999! Meine Frage hier und heute lautet - die Antwort wird entscheidend
sein -: Gilt diese bundesrätliche Antwort noch, oder gilt sie nicht
mehr?
Ich muss nämlich inzwischen feststellen, wenn es um die Interpretation
dieser Branchenüblichkeit geht, dass die respektiven Bundesämter
in diesem Zusammenhang ihre ganze intellektuelle Energie darauf verwenden,
nachzuweisen, dass diese Branchenüblichkeit gar nicht definierbar
ist. Betroffen sind rund 100 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
fast allesamt stimmberechtigte Schweizer Bürgerinnen und Bürger,
erfahrungsgemäss mit einer überdurchschnittlichen Stimmbeteiligung.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Wenn nicht bis zum Zeitpunkt der
von mir erwarteten bzw. befürchteten Volksabstimmung über
diese Geschichte hier auch in diesem Sektor Klarheit geschaffen wird,
werden diese Zustände letztendlich einen gewaltigen Einfluss auf
das Resultat dieser Volksabstimmung haben.
Es tut mir leid, dass ich als vermuteter Internationalist hier nicht
als Europhoriker auftrete; von dieser Sorte hat es in meiner Bewegung
eh genug. (Heiterkeit) Ich trete als alternder Realist auf und möchte
eigentlich, dass es uns in dieser Beratung gelänge, die vorliegende
Vorlage so zu beraten, dass die von verschiedenen Votantinnen und Votanten
beschriebene Verständigungslösung auch als Verständigungslösung
durch dieses Parlament geht.
Wie gesagt, auch Realisten müssen irgendwann abrechnen, und das
kommt erst am Schluss.
Die
ganze Debatte
|
|
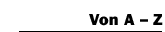 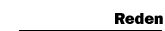  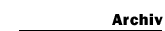 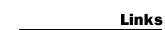 |