|
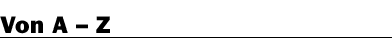
Ständerat:
Frühjahrssession 2004, 8. März 2004
Postdienste
für alle. Volksinitiative
Leuenberger
Ernst (S, SO): Ich wünschte mir, dass alle Leuenbergers hier im
gleichen Sinn kämpfen würden. Aber das wird uns nicht ganz
gelingen. (Heiterkeit)
Ich habe gestern klagend einem theologisch geschulten Freund mein Leid
anvertraut, ich müsste heute versuchen, den Ständerat zu überzeugen,
dieser Initiative zuzustimmen. Er hat mir, biblisch geschult, geantwortet,
eher werde ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass der schweizerische
Ständerat dieser Initiative zustimme. Ich habe ihm, mit Blick auf
meine Kolleginnen und Kollegen der CVP-Fraktion, geantwortet: "Den
Seinen gibt's der Herr im Schlaf." Wir werden ja dann am Schluss
sehen.
Ich bin überzeugt - und danke dem Kommissionsberichterstatter für
seine präzisen Ausführungen und auch für sein Bekenntnis
zu seinem damaligen Minderheitsantrag -: Es läuft letztlich darauf
hinaus, dass man sich streitet, ob man das Problem der ungesicherten
Finanzierung über die Verfassung oder besser über das Gesetz
regeln soll. Nachdem es uns hier in diesem Rate damals leider nicht
gelungen ist, diese Finanzierungsfrage über das Gesetz zu lösen,
bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als jetzt dafür zu plädieren,
dass man das über die Verfassung macht und dass das Volk Gelegenheit
erhält, sich dazu auszusprechen.
Ich stimme im Wesentlichen mit dem Kommissionssprecher, also dem Sprecher
der Mehrheit, überein, wenn er sagt, wichtige Punkte, die in dieser
Initiative aufgegriffen worden seien, seien inzwischen durch die Revision
des Postgesetzes erfüllt. Aber eben, der wichtigste Punkt - dort,
wo es um die Wurst, nämlich ums Geld geht - ist ausgesprochen nicht
erfüllt.
Worum geht es hier? Der Initiativtext, der bereits zitiert worden ist,
besagt: "Die Kosten für die Grundversorgung mit Postdiensten,
welche weder durch die Einnahmen aus den reservierten Diensten noch
durch Konzessionsgebühren gedeckt sind, werden vom Bund getragen."
Das ist letztlich die ganz banale Wahrheit, um die wir jetzt streiten
müssen. Gotthelf hat in einer Predigt einmal gefragt: "Woher
kömmt das Laster?" Dann kam eine Frau herein und sagte, sie
sei aus Lützelflüh, aber sie war ja gar nicht gemeint.
Woher kommen die Probleme hier? Ich muss Sie noch einmal daran erinnern
- ich will versuchen, es knapp zu tun -: Wir haben 1996 und 1997 eine
grosse PTT-Reform durchgeführt. Ich bin normalerweise ja kein Konservativer,
der der Vergangenheit nachtrauert, aber vor dieser PTT-Reform hat eine
Übung darin bestanden, dass der Postbereich der PTT aus den Erträgen
des Telekombereiches der PTT quersubventioniert worden ist. Das damalige
Parlament hat sich - meines Erachtens zu Recht - davon überzeugen
lassen, es sei für die Entwicklung des Postbereiches und für
die Entwicklung des Telekombereiches besser, diese beiden Bereiche organisatorisch
und juristisch zu trennen; das mag seine Richtigkeit haben. Falls es
jemand interessiert: Ich habe damals dieser Reform zugestimmt.
Nur eines muss ich hier gestehen - und jede und jeder von euch muss
zugeben -: Wir haben damals ein Problem gewaltig unterschätzt.
Man hat uns damals gesagt: Wenn die Quersubventionen vom Telekombereich
zum Postbereich nicht mehr fliessen - es ging da jährlich um 500
bis 800 Millionen Schweizerfranken -, ist das nicht so schlimm. Das
haben uns der Bundesrat und die Leitung der damaligen PTT gesagt. Die
Post könne das mit Rationalisierungsmassnahmen auffangen, und dann
sei das Problem gelöst.
Da waren wir - wir müssen auch einmal etwas zugeben - ein bisschen
leichtgläubig, denn inzwischen hat uns die Leitung des Unternehmens
"Die Post" doch damit in Verbindung gebracht, indem sie uns
gesagt hat: Ihr habt uns dieses wenig wirtschaftliche Poststellennetz
praktisch überlassen, aber ihr habt uns nichts gegeben, um das
zu finanzieren. Immerhin sei erwähnt, dass die Leitung der Post,
für einmal inklusive des von mir nicht besonders geschätzten
Verwaltungsrates, diesem Parlament über die Stimme des Bundesrates
einmal vorgeschlagen hat, weitere Geschäftsfelder zu öffnen,
um Erträge zu erwirtschaften und damit die defizitären Geschäftsbereiche
etwas aufzufangen - Stichwort: Postbank. Wir hier haben mit Mehrheit
entschieden: Das soll so nicht sein. Wenn wir das entschieden haben
- ich habe ja gelernt, Mehrheitsentscheide zu akzeptieren -, wenn das
schon entschieden worden ist, dann müssen wir uns fragen: Wer soll
denn letztlich für allfällig ungedeckte Kosten dieser Postgrundversorgung
aufkommen?
Es gibt die Möglichkeit - die Initianten erwähnen das in ihrem
Text -, dass man von den privaten Postveranstaltern Konzessionsgebühren
erhebt. Das ist eine Möglichkeit, von der meines Wissens bisher
nicht Gebrauch gemacht worden ist. Selbst wenn man davon Gebrauch machte,
würde diese Quelle vermutlich nie so ertragreich sein, dass sie
wesentliche Probleme der Grundversorgung lösen helfen könnte.
Wir haben die Post mit diesen politischen Vorgaben also praktisch in
den Wettbewerb geschickt. Es gibt ja einige private Postunternehmungen,
die sich in diesem Lande tummeln. Manchmal sieht man in einer Strasse
ein Auto der schweizerischen Post, dann noch zwei von privaten Postdiensten.
Wo das unter Effizienzkriterien sinnvoll sein kann, hat mir noch niemand
erklären müssen; aber man ist ja auch nicht verpflichtet,
mir etwas zu erklären, das ich nicht selber begreife.
Wir sind nun also in der Situation, dass wir uns fragen müssen:
Wie können wir garantieren, dass diese Grundversorgung auf Dauer
- nicht hier und heute, nicht jetzt, sondern auf Dauer - gesichert werden
kann? Denn der Bundesrat hat uns schon angekündigt, dass er unter
dem Einfluss von Normen, die die EU in diesem Bereich verabschiedet,
noch weitere Öffnungs-, weitere Liberalisierungsschritte vornehmen
muss.
Ein kürzlich erfolgter Schritt hat ja bereits gewisse Wirkungen
gezeitigt. Je mehr solche Öffnungsschritte da gemacht werden, desto
mehr ist letztlich die Grundversorgung durch die Schweizerische Post
gefährdet. Wenn Sie wirklich wollen - auch jene Ratsmitglieder,
die aus eher peripheren Gebieten stammen oder in deren Kantonen es auch
eher periphere Gebiete gibt -, dass dort eine flächendeckende Grundversorgung
weiterhin angeboten werden kann, brauchen wir eine Rechtsgrundlage,
damit der Bund letztlich als Garant für diese Grundversorgung wirken
kann. Dann ist er auch Garant mit dem Portemonnaie, wenn der Bund schon
verfügt, dass diese Post gewisse Dinge nicht machen kann, gewisse
Dinge nicht mehr machen soll, weil sie private Anbieter der Post wegschnappen.
Wir haben es hier also auch mit einem Stück Regionalpolitik zu
tun. Natürlich wird die Post sagen: Wir können nicht Regionalpolitik
betreiben, wir sind ein Unternehmen, das strikt nach betriebswirtschaftlichen
Prinzipien zu funktionieren hat. Ich habe hier eine Lücke der PTT-Reform
von damals zitiert; aber einige Lücken haben wir damals bewusst
nicht hinterlassen. Das damalige Parlament hat nämlich auf Antrag
des damaligen Bundesrates beschlossen, dass die Post nicht irgendeine
privatrechtliche Aktiengesellschaft ist. Man hat nicht einmal die Rechtsform
der spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft gewählt, sondern man
hat die Post in die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Institution
gekleidet oder man hat die Post als Anstalt ausgestattet. Ich erinnere
mich - als ob es gestern gewesen wäre - an die damalige Begründung.
Man hat genau mit diesem flächendeckenden Service-public-Auftrag
argumentiert und gesagt: Es kann nicht einfach ein Unternehmen XY sein,
das diese Aufgabe wahrnimmt, sondern das hat eben diese öffentlich-rechtliche
Anstalt zu machen. Um den Leuten die Sicherheit zu geben, dass das dann
tatsächlich auch erfolgt, hat man diese rechtliche Form gewählt.
Man hat dann allerdings dieser Post einen Verwaltungsrat gegeben. Wir
Parlamentarier haben uns damals vorgestellt, man würde dieser Post
einen Verwaltungsrat mit etwelcher Sensibilität für Service-public-Fragen
im Bauch, im Herzen und im Kopf geben. Leider hat der Bundesrat bei
der Auswahl der Verwaltungsräte dieses Element nach meiner Interpretation,
nach meiner Anschauungsweise nicht berücksichtigt, sondern hat
da eigentlich pickelharte Unternehmer in diesen Verwaltungsrat gesetzt.
Der neue Herr Verwaltungsratspräsident wusste nicht einmal, dass
die Post eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist, und er wusste
auch nicht, was das bedeutet. Das haben wir bei der parlamentarischen
Oberaufsicht festgestellt. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe etwas gestaunt,
und möglicherweise müssen Sie, Herr Bundesrat, diesen Herren
einmal ein Privatissimum gewähren und ihnen sagen, was sie eigentlich
zu tun haben.
Das haben wir nicht versäumt. Und wir haben auch nicht versäumt
und haben die Erinnerung daran nicht verdrängt, dass die Post -
das meine ich sehr ernst - eines der wichtigen und wenigen nationalen
Symbole in diesem Land geblieben ist. Die gelbe Post gehört zu
diesem Land, übrigens seit der Gründung. Es ist eine der ältesten
Institutionen der schweizerischen Eidgenossenschaft von 1848, sie wurde
1850 gegründet. Diese Post hat bis dato gehalten, und sie muss
weiter halten. Wir brauchen Elemente der Kohäsion in diesem Land.
Wir brauchen nationale Symbole, und die Post ist ein solches.
Das Abstimmungsresultat im Nationalrat ist Ihnen dargestellt worden:
95 zu 87 Stimmen; das lässt den Schluss zu, dass im Nationalrat
nicht nur irgendeine kleine Partei diese Initiative zur Annahme empfohlen
hat, sondern es braucht da zwei, drei oder vier, die dafür stimmen,
damit ein Potenzial von 87 Stimmen zustande kommt.
Ich bitte Sie eindringlich, auch wenn Sie in keiner Weise entschlossen
sind, dem nationalrätlichen Beispiel zu folgen - ich appelliere
insbesondere an die Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, die auch
periphere Gebiete beinhalten - zu diesem Service public Sorge zu tragen
und sozusagen als Sicherung für den Fall, dass wirklich alle anderen
Sicherungen durchbrennen, diesen Absatz 4 in die Bundesverfassung zu
schreiben.
Ich bitte Sie, damit eine gewisse Sicherheit zu geben und das Signal
auszusenden, dass wir, der schweizerische Ständerat, diese Institution
Post wollen, dass wir zu der öffentlich-rechtlichen Anstalt Post
stehen, dass wir zu diesem flächendeckenden Service public der
Post stehen und dass wir - weil wir seinerzeit die Finanzströme
vom Telekom- zum Postbereich gekappt haben und inzwischen die Telekom-Einnahmen
ganz einfach in die Bundeskasse vereinnahmen - bereit sind, wenn es
denn nötig sein sollte, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit
ungedeckte Kosten der Grundversorgung dann eben halt vom Bund finanziert
werden können.
Ich bitte Sie eindringlich, der Minderheit zuzustimmen und diese Initiative
zur Annahme zu empfehlen.
|
|
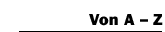 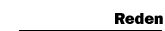  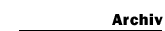 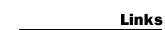 |