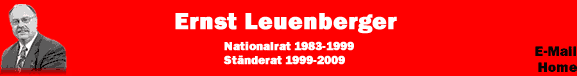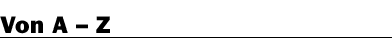
Ständerat: Sommersession, 06. Juni 2002
Antwort des Bundesrates
zur Interpellation Leuenberger Ernst.
Massive Dieselpreissenkung.
Auswirkungen
auf die Verkehrsverlagerung
Ganze
Dabatte zu diesem Geschäft
Die vom Interpellanten erwähnte Motion der UREK-SR 01.3690 fordert
den Bundesrat namentlich auf, eine Änderung der Gesetzgebung über
die Mineralölsteuern in der Weise in die Wege zu lenken, dass die
Besteuerung des Dieselöls signifikant - mindestens aber um 25 Rappen
- gesenkt wird, dies mit dem Ziel, eine wesentliche Minderung des CO-Ausstosses
des Strassenverkehrs zu erreichen. Diese Massnahme hätte neben
Auswirkungen auf den Klimaschutz, die Luftreinhaltung, die Finanzen
und den Tanktourismus auch Konsequenzen auf die Verkehrspolitik und
speziell auf das Verlagerungsziel beim Güterverkehr.
Die Fragen des Interpellanten können wie folgt beantwortet werden:
- Eine Verbilligung des Dieselpreises um 25 Rappen pro Liter bewirkt
eine Senkung der Transportkosten und damit eine Erhöhung der
Nachfrage im Strassengüterverkehr. Gleichzeitig wird der Schienenverkehr
stärker konkurrenziert, was zu einer Verlagerung von Schienenverkehr
auf die Strasse führt. Das Ausmass dieser Veränderungen
gegenüber der Trendentwicklung lässt sich gestützt
auf Berechnungen der Verwaltung wie folgt zusammenfassen:
Strassengüterverkehr:
Die Fahrleistungen beim Binnenverkehr nehmen als Folge einer Dieselverbilligung
von 25 Rappen je Liter um rund plus 1.1 Prozent (plus 20 Millionen
Fzkm) zu. Beim Import/ Export-Verkehr beträgt die Zunahme der
Fahrleistungen gegenüber dem Trend rund plus 1.4 Prozent (plus
5.9 Millionen Fzkm). Demgegenüber dürften die Auswirkungen
beim Transitverkehr gering bleiben, weil Transitfahrzeuge bei den
heutigen Preisverhältnissen kaum in der Schweiz tanken. Mit einer
Senkung um 25 Rappen pro Liter wäre der Dieselpreis in der Schweiz
wesentlich tiefer als im benachbarten Ausland (im EU-Raum hätten
nur Griechenland, Portugal und Luxemburg noch tiefere Dieselpreise).
Somit würde es betriebswirtschaftlich attraktiv, die Transitfahrzeuge
in der Schweiz zu betanken und gegebenenfalls dafür auch einen
beschränkten Umweg in Kauf zu nehmen. Das Ausmass des letzt genannten
Effektes dürfte aber eher gering sein.
Schienengütervekehr:
Als Folge der Dieselpreissenkung um 25 Rappen pro Liter würden
die Verkehrsleistungen der Schiene beim Binnengüterverkehr um
etwa minus 2.3 Prozent (minus 63.1 Millionen tkm) und beim Import/Export-Verkehr
um minus 1.5 Prozent (minus 29 Millionen tkm) zurückgehen. Die
Auswirkungen im Transitverkehr dürften wie beim Strassenverkehr
gering bleiben.
Insgesamt wirkt somit die von der ständerätlichen Motion
vorgeschlagene Senkung der Besteuerung bei den Dieseltreibstoffen
dem Verlagerungsziel der schweizerischen Verkehrspolitik strassen-
und schienenseitig zuwider.
- Der Bundesrat hat am 1. Mai seinen ersten Bericht zur Umsetzung
des Verlagerungsgesetzes veröffentlicht. Er zieht darin eine
erste positive Bilanz zur Umsetzung des Verlagerungsgesetzes. Gleichzeitig
hält der Bundesrat aber in diesem Bericht fest, dass zusätzliche
Massnahmen insbesondere für die schwierige Übergangsphase
bis zur schrittweisen Erhöhung der LSVA und bis zur Eröffnung
des Lötschberg-Basistunnels im Jahr 2007 notwendig sind. Schwerpunkte
sind die Verbesserung der Qualität im internationalen Schienengüterverkehr,
die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen sowie eine Erhöhung
der Bestellungen im kombinierten Verkehr und der Bundesbeiträge
für Terminals- und Anschlussgeleise. Auch die Bahnen selbst verfügen
noch über betriebliche Optimierungsmöglichkeiten, welche
es auszuschöpfen gilt. Obschon die erwähnten Massnahmen
speziell zur Beeinflussung des alpenquerenden Verkehrs konzipiert
wurden, kommen sie zumindest teilweise auch dem übrigen Verkehr,
welcher aufgrund seiner Zusammensetzung vor allem von einer Dieselpreissenkung
betroffen wäre, zugute. Weitergehende Massnahmen sind deshalb
nach Meinung des Bundesrates nicht ins Auge zu fassen.
- Dieselmotoren emittieren bis zu tausend Mal mehr lungengängigen
Feinstaub und erzeugen rund drei Mal mehr Stickoxide als Benzinmotoren.
Die feinen Staubteilchen sind so klein, dass sie durch normale Abwehrreaktionen
des Körpers in den Lungen nicht herausgefiltert werden und tief
in die Bronchien und Alveolen und sogar ins Blut gelangen können.
Feinstäube in der Atemluft haben deshalb ein grosses Krebs erzeugendes
Potenzial, können zu Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen
führen, erhöhen das Herzinfarktrisiko, verringern die Lungenfunktion
und vermindern die Lebenserwartung. Selbst mit den neuesten Motorentechnologien
(Euro 4, vorgeschrieben für Neuwagen ab 2005) und der Verwendung
von schwefelfreien Treibstoffen ist das Krebs erzeugende Potenzial
von Dieselabgasen rund zehn Mal grösser als das jenige von Bezinabgasen.
Das gesamte humantoxische Potenzial ist rund doppelt so hoch.
Aus der Sicht der Gesundheit, der Luftreinhaltung und der Verkehrspolitik
ist die Verbilligung von Dieseltreibstoffen mit der heute gängigen
Motorentechnologie abzulehnen. Auf eine Förderung des Diesels kann
eingetreten werden, wenn schwefelfreie Treibstoffe flächendeckend
eingeführt und die motorentechnologischen Voraussetzungen (Partikelfilter,
DeNox-Katalysatoren) gegeben sind. Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
soll, unter Berücksichtigung dieser Anforderungen, die Möglichkeit
einer ertragsneutralen Differenzierung der Mineralölsteuer auf
Treibstoffen prüfen.
Interpellation Ernst
Leuenberger
Ernst Leuenberger
zur Antwort des Bundesrates
|
|
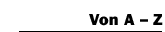 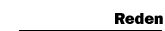  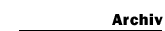 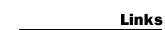 |