|
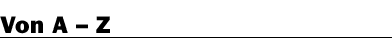
«Die Löhne
dürfen nicht vor den Preisen purzeln»
Etappensieg für Eisenbahnerchef Ernst Leuenberger
im Lohnstreit der Lokführer. Bis auf weiteres wird die BLS Cargo
keine tiefer bezahlten deutschen Lokführer durch die Schweiz fahren
lassen. Doch sind die höheren Schweizer Löhne auf Dauer haltbar?
Work. Die
Zeitung zur Arbeit. Interview: Marie-Josée Kuhn
work:
Herr Leuenberger, was haben Sie gegen deutsche Lokführer?
Ernst Leuenberger: Überhaupt nichts. Wir haben verschiedene deutsche
Lokführer im Eisenbahnerverband, die hier arbeiten und bei schweizerischen
Unternehmungen zu schweizerischen Bedingungen angestellt sind. Leider
gibt es neuerdings auch deutsche Lokführer, die hier arbeiten und
die von deutschen Unternehmen zu deutschen Bedingungen angestellt sind
und unter der Flagge von Cargo BLS arbeiten. Ich spreche namentlich
von der Deutschen Bahn und ihrer Cargo- Tochtergesellschaft Railion:
Diese zahlt ihren Lokführern, die in der Schweiz arbeiten, ungefähr
dreissig Prozent weniger Lohn als hier üblich. Und jetzt kommt
das Problem: Wenn wir vom SEV einfach zusehen, wie tiefer entlöhnte
Lokführer durch die Schweiz fahren, wird früher oder später
das Lohngefüge ins Rutschen kommen. Nicht nur bei den Lokführern,
sondern bei allen Eisenbahnerberufen. Wir hätten dann den klassischen
Fall von Lohndumping.
Dreissig
Prozent Lohnunterschied: Sind derart grosse Differenzen bei offenen
Grenzen überhaupt haltbar?
Ich habe da so meine Bedenken. Die Schweiz ist eine Hochpreisinsel,
dementsprechend sind auch die Löhne. Rein ökonomisch betrachtet,
werden die höheren Schweizer Löhne auf die Dauer nicht haltbar
sein. Was Sie da ansprechen, ist die alte Streifrage: Was purzelt zuerst
bei der Angleichung der Schweiz an die EU, die Preise oder die Löhne?
Logisch, dass sich die Gewerkschaften dagegen wehren, dass zuerst die
Löhne purzeln sollen. Schauen wir die Baubranche an: Dieselbe BLS
baut am Lötschbergtunnel im Auftrag der Eidgenossenschaft zu ortsüblichen
Bedingungen. Alle Bauarbeiter, auch jene einer österreichischen
Baufirma, sind dort dem Landesmantelvertrag im schweizerischen Baugewerbe
unterstellt. Das heisst, am Lötschbergtunnel werden Schweizer Löhne
bezahlt. Das ist normal und entspricht schweizerischem Recht.
Offenbar
ist das Eisenbahngesetz bei der Definition dessen, was branchen- und
ortsübliche Arbeitsbedingungen sind, aber gar nicht so klar.
Das Gesetz schreibt klar branchenübliche Bedingungen vor. Das Bundesamt
für Verkehr soll jetzt interpretieren, was das genau heisst. Es
soll prüfen, ob deutsche Lokführer in der Schweiz Schweizer
Löhne erhalten müssen oder nicht.
Was
werden Sie tun, wenn das Bundesamt gegen Ihre Interessen entscheidet?
Wir brauchen dringend analog zur Baubranche einen Landesmantel- oder
Gesamtarbeitsvertrag für die schweizerischen Normalspurbahnen.
Und dieser GAV muss allgemeinverbindlich erklärt werden.
Wird
der Entscheid des Bundesamtes über die Bahnbranche hinaus von Bedeutung
sein?
Rein rechtlich nicht, politisch dagegen schon. Sowohl im Fernmeldegesetz
als auch im Postgesetz werden ebenfalls branchenübliche Arbeitsbedingungen
verlangt. Der Entscheid des Bundesamtes für Verkehr dürfte
deshalb auch unsere Schwestergewerkschaft Kommunikation interessieren.
Ausserdem wird der Entscheid sicher auch im Vorfeld kommender Abstimmungen
über die Bilateralen II seine Auswirkungen haben. Falls wir bei
den Lokführern jetzt sang- und klanglos untergehen, was ich nicht
hoffe, würde sich wohl manch ein Arbeitnehmer den einen oder anderen
Gedanken darüber machen, wie sinnvoll eine so unerhörte Grenzöffnung
ist.
Höre
ich da EU-feindliche Untertöne?
Überhaupt nicht. Ich bin kein Euro-Turbo, aber als Realo meine
ich, mit einem EU-Beitritt könnten wir bei all den Gesetzen, die
uns sowieso beeinflussen, wenigstens mitreden.
Gibt
es einen Zusammenhang zwischen dem Alleingang der Schweiz und ihrem
Dasein als Hochpreisinsel?
Ökonomen sagen, die Schweiz hätte in den 90er Jahren kein
so niedriges Wirtschaftswachstum gehabt, wäre sie 1992 dem EWR
beigetreten. Die wirtschaftliche Entwicklung von Österreich lässt
zumindest die Vermutung zu, dass diese These einiges für sich hat.
Wir haben da offenbar einiges verpasst.
Und
was sind denn jetzt die Folgen davon?
Schafft man bei sozialen oder ökonomischen Entwicklungen künstliche
Stausituationen, dann laufen die Prozesse später mit einem so enormen
Tempo ab, dass die Strukturanpassungen absolut brutal werden. Das hat
mit der EU wenig, mit der politisch gewollten Strukturerhaltung dagegen
sehr viel zu tun. So viel habe ich von einem belgischen Gewerkschaftskollegen
anhand des Beispiels belgische Stahlindustrie gelernt. Der belgische
Staat unterhielt seine Stahlindustrie mit Protektionsmassnahmen und
Subventionen so lange, bis der Damm brach. Auf einen Schlag musste diese
Industrie umstrukturiert werden, was enorme Folgen auf den ganzen Landesteil
Wallonien hatte.
Laut
Bundesamt für Statistik sind die Löhne hier zwar viel höher
als in Deutschland, die Kaufkraft dagegen ist viel tiefer. Der deutsche
Lokführer kann sich trotz tieferem Lohn also etwa gleich viel leisten
wie sein Schweizer Kollege.
Der deutsche Lokführer kann in Deutschland mit seinem niedrigeren
Lohn leben. Der Schweizer dagegen kann mit einem deutschen Lohn hier
nicht leben. Das ist das eine. Das andere: Wenn die Deutsche Bahn –
und das ist offenbar die Zukunft – in der Schweiz rumfahren kann
mit ihrem nominell tiefer entlöhnten Personal, verdrängt diese
Entwicklung automatisch die Schweizer Lokführer samt den Schweizer
Bahnbetrieben.
Dass
die Gewerkschaften die Löhne der Arbeitnehmenden verteidigen, ist
klar. Warum aber sind sie so zurückhaltend in Sachen Preispolitik?
Das stimmt nicht. Ich erinnere an die Diskussionen um die Revision des
Kartellgesetzes. Da waren wir Gewerkschafter im Parlament stark engagiert,
zum Beispiel beim Zementpreis. Selbstverständlich gibt es neben
der Kartellpolitik auch andere Gründe für die Hochpreisinsel
Schweiz: die teure Agrarpolitik, das teure, perfektionistische Bauen,
die hohen Bodenpreise. Da gibt es sicher Handlungsbedarf.
|