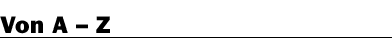
Referat:
Vom Arbeitersohn zum Manager
Die Karriere von Ernst Leuenberger zeigt: Karriereknicks und Umwege müssen gewagt werden; Auseinandersetzungen und Konflikte machen einen stärker.
Was soll denn einer, dessen Werdegang aus dem 20. Jahrhundert datiert, dem staunenden Publikum über Karriereplanung im 21. Jahrhundert sagen können? Wie soll der Spötter hier als Referent dienen, der stets mit lausbübischer Freude den Willi-Ritschard-Spruch zitiert: «Je höher der Affe klettert, desto besser sieht man seinen Hintern.»? Was soll denn der Beobachter hier, der die Erfahrung gemacht hat, dass die Menschheit aus unglücklichen Armen und lückenlosen Reichen besteht, oder etwas schöner gesagt mit Peter Bichsel: «Die Schweiz besteht aus Reichen und solchen, die reich werden wollen.»?
Was ist Karriere? Geht es um die Bewältigung des Lebens in Anstand und Rechtschaffenheit, ohne den andern zur Last zu fallen? Geht es darum, ein nützliches Glied der Gesellschaft zu sein, das heisst, am Platz, an den man gestellt worden ist, etwas zu leisten? Geht es im Zeitalter der Globalisierung darum, zu jenen zu gehören, die nicht verhungern, nicht erfrieren, nicht erschlagen werden von jenen, die auch nicht verhungern wollen? Geht es darum, Erkenntnisse zu gewinnen, ar weise zu werden?
Geht es darum, ein Karrierist zu werden, sich mit Geld, Titeln und den Accessoires der Schönen und Reichen zu schmücken? Geht es darum, Machtpositionen zu erringen, sich durchzusetzen, Macht auszuüben? Geht es darum, mit seiner ganzen Kraft, seinem ganzen Wissen und Können Verantwortung zu übernehmen für das Ganze oder wichtige Teile vom Ganzen?
Es ist die letzte Umschreibung, die meiner Vorstellung von Karriere entspricht.
Ein kleiner Bub und seine Karriere
Vor Ihnen steht ein Politiker, ein Gewerkschaftschef, der Zeugnis ablegen kann über seinen Weg, seine Weggefährten, die Leiden und Freuden eines Engagierten, über die Tücken des Sich-Bewegens im öffentlichen Raum. Ein Psychologe könnte etwa sagen, da habe ein kleiner Bub seinen Emmentaler Grossvater, Bauer und BGB-Gemeindemann bewundert und ihm nacheifern wollen. Ein Soziologe könnte beifügen: Da hat einer seinen Vater gerächt. Den Vater, der als Bauernsohn Bauer werden wollte, aber strukturbereinigt wurde, in der Fabrik landete. Also wurde der Arbeitersohn Sozialist. Der Sohn jedenfalls geht mit 20 zur SP, wird sofort Mitlied der kommunalen Finanzkommission, weil man annimmt, er könne als Student etwas rechnen. Dieser Wunderknabe besteht mit 22 seine erste Volkswahl auf Gemeindeebene und wird prompt gewählt. Das hätte ja munter weiter gehen können, wenn nicht der erste Karriereknick eingetreten wäre: Als 1945 Geborener kam ich ja 1965 an die Uni in die Grossstadt Bern und gründete eine linke Studentengruppe; las alle Rororo- und Suhrkamp-Taschenbücher über Vietnam und den weltweiten Protest gegen die Supermacht USA. Das alles war nicht gerade karrierefördernd: jedenfalls fand ich nach Studienabschluss in Bern keinen Job: Ich wurde nicht Fraktionssekretär der SP-Fraktion der Bundesversammlung. Ich wurde damals in Bern nicht Gewerkschaftssekretär, ich wurde nicht einmal Hilfslehrer, was damals jeder Jungakademiker werden durfte, der einen ganzen Satz aussprechen konnte. Mein Name stand bereits in den Fichen, was ich damals nicht wissen konnte und erst 1989 nach dem Kopp- und Mauerfall erfuhr.
Ich kam 1973 nach Solothurn, ins Exil, in die Provinz, wie ich damals befürchtete, als Gewerkschaftssekretär. Die politische Karriere stockte. Ich erlebte die Serie der erfolglosen Volkswahlen. Ich war vorerst nicht wählbar.
Hier wäre nun ein Kapitel aus einem möglichen Erziehungsroman einzuflechten mit Unterkapiteln:
Wie die Solothurner Metall-, Uhren-, Schuh- und Papierarbeiter, Bähnler und Pöstler ihren Gewerkschaftssekretär erziehen. Wie die Uhrenkrise der siebziger Jahre, die Von-Roll- und die Bally-Krise den Arbeitern zeigt, dass ihr Gewerkschaftssekretär vielleicht doch nicht der Dümmste ist. Wie der Gewerkschaftssekretär heiratet, seiner Frau verspricht, 50 Prozent der Erziehungs- und Hausarbeit zu übernehmen, aber als Hausmann kläglich scheitert. Wie Willi Ritschard dem Gewerkschaftssekretär beibringt, dass er Nationalrat werden müsse. Wie der Gewerkschaftssekretär daraufhin Nationalrat, Nationalratspräsident und Solothurner Ständerat wurde. Wie Ritschard dem Gewerkschaftssekretär empfiehlt, kein sturer Gewerkschaftsbüffel zu werden, sondern sich auch anderweitig zu engagieren, und wie der Gewerkschafter dann 25 Jahre lang Medienpolitik in leitenden Gremien der SRG machte. Wie der kleine Gewerkschaftssekretär Chef der grossen Gewerkschaft der stolzen Eisenbahner wurde in der grössten Krise der Eisenbahn seit deren Bestehen, und wie der Gewerkschaftsboss seinen Leuten sagt, diese Krise sei der rosse Challenge, die ganz grosse Herausforderung, und wie es gelte, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Und: Wie der Gewerkschaftsboss seinen Lohn reduziert und versucht, Arbeit auf mehr Hände und Köpfe zu verteilen.
5 Punkte aus dem Gelernten
Soweit der Erfahrungsbericht, und nun meine Moral von der Geschichte:
Sich engagieren, gestalten wollen, Umwege riskieren
Erkenntnisse gewinnen, Einsichten erwerben, Karriereknicks wagen, Glaubwürdigkeit erreichen, Vertrauen schaffen, für etwas stehen, Absage an Opportunismus und Populismus –das sind grosse Worte gelassen ausgesprochen. In einem Medienzeitalter, wo alles an Personen aufgehängt werden muss, kann es teuer und schmerzhaft werden, wirklich hinzustehen. Aber auf längere Sicht verhelfen nur klare Positionen zu Glaubwürdigkeit. Es ist billig, jetzt den Satz zu zitieren: «Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.» Aber das berühmte Körnchen Wahrheit ist auch diesem Satz eigen. Und bitte: Misstrauen Sie jenen PR-oder gar Kommunikationsberatern, die Ihnen sagen, mit einer Million sei aus jedem Kartoffelsack ein Bundesrat zu machen. Ein guter Bundesrat ganz sicher nicht.
Bildung erwerben, Ausbildung machen, Weiterbildung pflegen
Dass ich zum Schluss gekommen bin, learning bei doing sei der beste Weg, hängt damit zusammen, dass ich dezidiert der Meinung bleibe, man müsse auch Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen. So banal es tönt, Sprachen lernen im Sprachgebiet in der beruflichen Praxis gehört für mich unverzichtbar dazu; gerade weil ich es nicht geschafft habe.
Dass heute gleichzeitig Spezialisten und Universalgenies gefragt sind, gehört zum Zeitgeist. Die Gefahr, als Spezialist zum Fachidioten zu werden, ist allgegenwärtig. Und der Weg vom Fachidioten zum nützlichen Idioten ist ein kurzer.
Sich auseinander setzen mit Menschen, mit Leitbildern, mit Leitfiguren
Auseinandersetzung heisst Konflikte wagen, stärker werden. Es hilft nichts, sich einem Mentor anzuhängen und in Funktion von ihm zu wirken. Das führt bestenfalls zu einem Marionettendasein. Man braucht nicht ein Dialektiker im Hegelschen Sinne zu sein, um zu begreifen, dass nur in der Auseinandersetzung Neues und Besseres entstehen kann. Beziehungsnetze knüpfen ist lebensnotwendig für soziale Wesen, was die Menschen nun mal sind. Aber: nur von und durch Beziehungen leben und Karriere machen zu wollen, ist verderblich. Wer eine Kaderposition innehat und an allen Ecken und Enden irgendjemandem etwas schuldig ist, verkommt zur Marionette.
Rückfallpositionen sichern
Ein intaktes privates Umfeld aufbauen, schaffen und pflegen. Denn Partnerschaft und wahre Freunde stärken den Rücken.
Die Menschen mögen, die Menschen gern haben
Ich weiss, ich habe Ihnen kein Rezeptbuch geliefert, wie man im 21. Jahrhundert Karriere machen kann. Ich habe aus dem 20. Jahrhundert berichtet und nehme an, die grundlegenden Anforderungen an die Verantwortungsträger würden auch im 21. Jahrhundert nicht wesentlich ändern. Ich spreche von Verantwortungsträgern, weil ich davon ausgehe, dass es letztlich darauf ankommt, dass immer wieder Menschen ins Leben starten mit dem starken Willen, dem Ganzen zu dienen; mit dem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen.
|
|
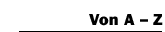 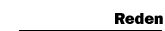  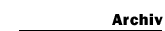 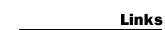 |