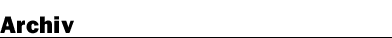
Jubiläumssitzung
«150 Jahre Bundesversammlung»
Freitag,
6. November 1998 14.30 h
Vorsitz:
Leuenberger Ernst (S, SO) ___________________________________________________________
Herr Bundespräsident,
Frau Vizepräsidentin des Bundesrates,
meine Herren Bundesräte,
Herr Ständeratspräsident,
meine Damen und Herren Mitglieder des Ständerates und des Nationalrates,
verehrte Referentin,
verehrte Referenten,
liebe Gäste,
liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer!
Diese Einleitung gibt mir Gelegenheit, die Abwesenheit von Herrn Bundesrat
Moritz Leuenberger zu entschuldigen, der eine unaufschiebbare Verpflichtung
gegenüber dem französischen Verkehrsminister hat. Vielleicht gelingt
den beiden Herren etwas Zukunftsträchtiges!
Die Vereinigte
Bundesversammlung tritt heute, gegen das Ende des Jubiläumsjahres «150
Jahre Bundesstaat», zu einer Festsitzung zusammen. Wir wollen damit
zweierlei zum Ausdruck bringen:
1. Wir
erinnern uns damit an den Montag, 6. November 1848, an den Tag, an welchem
zum erstenmal in der Schweizer Geschichte die neu gewählten eidgenössischen
Räte tagten. Ein Blick in die damaligen Ratssäle mag für Sie höchst
interessant sein: Der Nationalrat zählte an sich 111 Mitglieder, es
waren aber noch nicht alle gewählt; es kamen also noch nicht 111 zusammen.
Laut Erich Gruner, dem Berner Politologen, waren von diesen 111 Nationalratsmitgliedern
87, also 80 Prozent, den Radikalen zuzurechnen, 10 dem Liberalen Zentrum;
zudem gab es 9 Katholisch-Konservative und 5 Evangelisch-Konservative.
Im Ständerat herrschten ähnliche Verhältnisse: 30 Radikale, 8 vom Liberalen
Zentrum und 6 Katholisch-Konservative.
Für historisch
Interessierte mag es ausserdem interessant sein, hier zu vernehmen,
dass die erste Sitzung des Nationalrates im alten «Casino» stattfand,
das just an der Stelle unseres heutigen Parlamentsgebäudes stand. Nationalratspräsident
wurde der Berner Ulrich Ochsenbein, aus Nidau – von den Konservativen
auch als «Freischarengeneral» bezeichnet. Dem Ständerat wurde das «Rathaus
zum Äusseren Stand» an der Zeughausgasse als Tagungslokal zur Verfügung
gestellt. Erster Ständeratspräsident wurde Jonas Furrer aus Winterthur.
Beide waren nur rund zwei Wochen lang Ratspräsidenten; beide wurden
nämlich zehn Tage später in den ersten Bundesrat gewählt, Herr Jonas
Furrer gleich auch zum Bundespräsidenten.
2. Wir
wollen uns vom Zukunftsglauben der Staatsgründer von 1848 «etwas anstecken
lassen» und uns heute Gedanken über die Zukunft unseres Wirkens, über
die Zukunft der Politik, über die Zukunft der Institutionen und über
die Zukunft unseres Landes machen. Sie erinnern sich an die Anlässe
dieses Jubiläumsjahres: Am vergangenen 4. Juni hat der Bundesrat die
Staatsoberhäupter der fünf benachbarten Staaten, die Vertreterin der
Präsi-dentschaft der Europäischen Union und eine Vertreterin der Uno
in diesem Saal empfangen, um die heutige schweizerische Verbundenheit
mit unseren Nachbarländern, mit Europa und mit der ganzen Welt zu betonen.
Sie erinnern sich ebenfalls des 12. Septembers, als der Bundesrat die
Kantonsregierungen, Vertreterinnen und Vertreter der Jugend, Vertreterinnen
und Vertreter von Wissenschaft und Kultur auf dem Bundesplatz empfangen
hat. Dieser Anlass hat an den 12. September 1848 erinnert, an den Tag,
als die Tagsatzung zusammentrat, um die Annahme der Bundesverfassung
durch Volk und Stände festzustellen.
Junge Leute
haben am 12. September 1998 in Tanz und Aktion die heutige und zukünftige
Schweiz, «ihre» Schweiz, zur Darstellung gebracht. Wir wollen diesen
jungen Leuten heute von hier aus nochmals für dieses eindrückliche Engagement
und ihre Darbietungen danken.
Ich darf
sodann einige Anwesende ausserhalb des «Normal-bestandes» der Vereinigten
Bundesversammlung speziell begrüssen: Ich begrüsse als externe Referentin
und externe Referenten die Philosophin Annemarie Pieper aus Basel, den
Architekten Mario Botta aus Lugano und den Historiker Jean-Claude Favez
aus Genf.
Ich begrüsse
sodann mit Freude die Vertretungen aller sechsundzwanzig kantonalen
Parlamente und werte die Teilnahme der Präsidentinnen bzw. Präsidenten
der Kantonsräte, der Landräte, der Grossen Räte und des Parlement ju-rassien
als Ausdruck des Willens, den Föderalismus als Ge-staltungselement schweizerischer
Politik zu leben und sinnvoll weiterzuentwickeln. Es ist mir etwas sehr
Positives aufgefallen: Zehn von sechsundzwanzig kantonalen Parla-menten
werden derzeit von Präsidentinnen geleitet, was immerhin eine Quote
von 40 Prozent ausmacht und gewiss zu-kunftsversprechend ist. (Beifall)
Besonders
willkommen heissen darf ich sodann die ehemaligen Mitglieder des Bundesrates
sowie die Damen und Herren alt Präsidentinnen und alt Präsidenten des
Nationalrates und des Ständerates. Ich begrüsse sodann die Präsidenten
des Bundesgerichtes und des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichtes.
Unser Gruss gilt weiter den Damen und Herren Chefbeamtinnen und Chefbeamten
des Bundes.
Es freut
uns auch immer wieder, wenn wir die städtischen Behörden von Bern bei
uns begrüssen dürfen, heute angeführt durch die Frau Stadtratspräsidentin
und den Herrn Stadtpräsidenten. Die Bundesversammlung ist den städtischen
Behörden von Bern dankbar, dass sie den eidgenössischen Räten, der Bundesverwaltung
und selbstverständlich dem Bundesrat seit 150 Jahren Gastrecht gewähren.
Der Herr Stadtpräsident weiss sogar zu berichten, dass der erste Bundesrat
mangels eines eigenen Gebäudes jeweils im Erlacherhof getagt habe, dort,
wo heute die Stadtregierung ihre Sitzungen durchführt. Die Tatsache,
dass die städtischen Behörden demnächst eine Jubiläumsfeier durchführen,
um an den Tag zu erinnern, als die Parlamentskammern beschlossen, Bern
zur Bundesstadt zu bestimmen – dass sie diesen Anlass feierlich begehen
–, werten wir als Zeichen dafür, dass sie uns noch eine Zeitlang behalten
wollen.
Ich begrüsse
sodann die Medienschaffenden, die den Behörden aller Stufen immer wieder
helfen, ihre Botschaften in allen Gegenden des Landes zu verbreiten.
Medienschaffende auch, die geschützt durch die verfassungsmässig verbriefte
Pressefreiheit ihre Arbeit, mal wohlwollend beobachtend, mal eher kritisch
würdigend, zum Wohle von Land und Volk ausüben oder mindestens ausüben
wollen. Gewiss, ohne Spannungen zwischen Behörden und Medienschaffenden
ist das nicht zu haben. Der grosse – leider verstorbene – Publizist
Oskar Reck hat jeweils gesagt: Dort, wo keine Spannungen zwischen Medien
und politisch Handelnden bestünden, herrsche nicht Demokratie, sondern
Diktatur.
Ich heisse
auch alle jetzt nicht namentlich erwähnten Gäste bei uns sehr herzlich
willkommen!
Ich erlaube
mir, in zwei, drei Worten auch auf die Zukunft dieses Landes einzugehen
und zu unterstreichen, dass wir, dieses Land, dieses Volk, Zukunftsprojekte
brauchen. Wir brauchen die Begeisterungsfähigkeit weitester Kreise für
Zukunftsprojekte; wir brauchen aber auch den unverbrüchlichen Glauben
an die Zukunft dieses Landes Schweiz. Zentral ist der Wille zur Innovation
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Was wäre denn – wie Ernst Bloch
einmal gefragt hat – menschlicher, als über das hinauszugehen, was ist?
Natürlich werden in diesem Zukunftsdiskurs einige Leute auch Horrorvisionen
entwickeln. Ich füge bei: Auch das brauchen wir aus dialektischen Gründen.
Dieses Land hat eine Zukunft. Dieses Land hat Zukunftsprojekte. Ich
nenne: Schweizer Solidarität mit den vom Elend in der weiten Welt Betroffenen
tut not. Die Idee der Solidaritätsstiftung zeigt den Weg, die Weiterentwicklung
der humanitären Tradition ist die Verpflichtung dazu.
Die Schweiz
braucht kreatives Arbeiten an neuen Modellen des sozialen Ausgleiches.
Ich denke z. B. an die Verteilung der Arbeit auf alle arbeitswilligen
und arbeitsfähigen «Hände und Köpfe», auch das ist ein Zukunftsprojekt.
Denn ohne so- zialen Ausgleich ist diese Schweiz nicht vorstellbar.
Und nicht von ungefähr gehörten zu den grössten Bewährungsproben des
heute 150jährigen Bundesstaates der Generalstreik vom November 1918
und das anschliessende jahrzehntelange Ringen um den sozialen Ausgleich.
Die Schweiz braucht die Annäherung an Europa. Die Europäische Union
ist nämlich auch ein Friedenswerk, an dem mitzugestalten eine vornehme
schweizerische Aufgabe sein könnte. Die Schweiz mit ihrer reichen Erfahrung
als Friedensstifterin wird in den Vereinten Nationen, in der Uno, er-wartet.
Und zuletzt, aber nicht das Mindeste: Endlich wird sich diese Schweiz
zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine zeitgemässe, moderne Bahninfrastruktur
geben. Auch das ein Zukunftsprojekt. (Teilweise Unruhe) Wir haben die
Aufgabe, unserem Volk Zukunftsvorstellungen aufzuzeigen. Wir haben die
Pflicht, für kommende Generationen an der «Idee Schweiz» weiterzuarbeiten.
Wir wollen das entschlossen tun, fröhlichen Herzens und offenen Sinns,
zur Ehre der Staatsgründer von 1848. (Beifall)
|
|
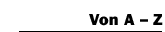 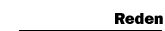  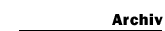 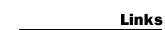 |