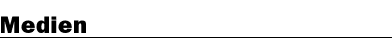
Solothurner Zeitung vom 25.9.99
«Habe immer noch Spass am Politisieren»
Gespräche mit den Solothurner Wiederkandidierenden: heute mit SP-Nationalrat Ernst Leuenberger
SP-Nationalrat Ernst Leuenberger hat den Spass am Politisieren auch nach 16 Jahren im Parlament noch nicht verloren. «Mit 54 Jahren bin ich noch nicht pensionsreif», sagt Leuenberger. Das Jahr als Nationalratspräsident habe zwar seinen Bekanntheitsgrad weiter erhöht, sein politischer Stil sei aber der gleiche geblieben, meint der Solothurner, der dieses Jahr für den Ständerat kandidiert.
MIT ERNST LEUENBERGER SPRACH GIOVANNI LEARDINI
Sie sitzen schon seit 16 Jahren im Parlament. Zu lange?
Nein. Nach 16 Jahren im Nationalrat verfüge ich über eine sehr grosse Erfahrung und ein sehr gutes Beziehungsnetz. Ich muss politisch das Rad nicht alle Tage neu erfinden. Im Übrigen bin ich mit 54 Jahren noch nicht pensionsreif, und der Spass am Politisieren, an den Kontakten mit den Leuten besteht immer noch.
In einem Parlamentarier-Test der Zeitschrift «Beobachter» werden Sie als «Medienstar» bezeichnet.
Das bin ich sicher nicht. Wenn ich den Begriff Medienstar höre, stelle ich mir einen Politiker, vor, der gleich losrennt, wenn er irgendwo eine Fernsehkamera oder einen Fotografen sieht, oder der Filippo Leutenegger in Zürich anruft und fragt, ob er auch mal in die «Arena» kommen kann, auch wenn es nur in der dritten Reihe ist. Ich bin irgendwie auch zu stolz, mich so mediengeil zu verhalten. insofern bin ich kein Medienstar. Auf der anderen Seite bin ich auf die Medien angewiesen, wenn ich die grosse Zahl der Stimmberechtigten erreichen will. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich keine Interviews gebe oder mich nicht fotografieren lasse. Das wäre ja dumm.
Das tönt bescheiden. Aber Sie sind doch der einzige noch aktive Solothurner Parlamentarier der auch auf nationaler Ebene bekannt ist.
Scheinbar hinterlasse ich bei meinen Auftritten gewisse Spuren. Was ich den Leuten vermitteln möchte, ist mir sehr ernst. Doch ein wenig Humor gehört auch dazu. Deshalb versuche ich meine Botschaften so unter die Leute zu bringen, dass es nicht nur staubtrocken ist wie ein Chilbi-Lebkuchen, sondern vielleicht etwas angereichert um ein paar leichter verdauliche Elemente. Willy Ritschard sagte einmal zu mir: «Ich muss an eine Bauarbeiterversammlung gehen. Die Leute dort haben neun Stunden hart gearbeitet. Wenn ich vor ihnen referieren würde, die schlafen doch einfach ein. Also muss ich so zu ihnen sprechen, dass sie auch ein wenig erheitert werden.»
Ihr Jahr als Nationalratspräsident hat Ihnen auch eine grössere Präsenz in den Medien gebracht.
Ich bin überzeugt davon, dass mir das Präsidialjahr noch mehr Bekanntheit eingebracht hat.
Ein Jahr als «höchster Schweizer». Das muss doch jeden Politiker verändern. Sind sie ruhiger geworden?
Ich halte mich eigentlich nicht für einen sehr ruhigen Typen. Wenn ich meine Wochenabläufe anschaue, dann ist das eher eine unruhige Geschichte. Mein Stil beim Austragen von Auseinandersetzungen ist nicht wesentlich anders geworden. Ich bin für deutliche Worte, bin allerdings nicht unversöhnlich. ich habe meinen Standpunkt, und von diesem aus bin ich bereit, mit anderen tragfähige Kompromisse und Lösungen zu suchen - und vor allem, die gefundene Lösung auch durchzusetzen, was letztlich entscheidend ist.
Als Ratspräsident mussten Sie sich aber stark zurückhalten?
Auf jeden Fall, ja. Die Sitzungsleitung ist eine Aufgabe, die ganz bestimmten Regeln gehorcht. Man darf nicht parteiisch sein, das geht nicht, und würde auch nicht akzeptiert. Gleichzeitig wird aber akzeptiert, dass man noch einen eigenen Standpunkt hat. Der Nationalratspräsident hat ja nach Reglement das Recht, seine Meinung - als solche deklariert - in Diskussionen einzubringen. Das habe ich gelegentlich mit Nebensätzen, aber nicht ganz wirkungslos, getan.
Stark engagiert haben Sie sich bei zwei Abstimmungsvorlagen im vergangenen Jahr: Zur Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Als Bahngewerkschafter ist das verständlich, aber als Nationalratspräsident...?
Ja, für diese Vorlagen musste und wollte ich mich von Berufs wegen engagieren. Dafür habe ich die von allen akzeptierte Begründung gefunden: Der Ratsvorsitzende darf sich für Vorlagen einsetzen, die vom Bundesrat und von der Mehrheit des Parlaments unterstützt werden. Ich habe damals sogar an Podiumsgesprächen. teilgenommen mit anderen Parlamentariern, und es hat nie jemand gesagt, dass ich das als Nationalratspräsident nicht tun dürfe.
Das Volk hat beiden Vorlagen deutlich zugestimmt.
Ja, aber es hat lange nicht danach ausgesehen. Noch ein halbes Jahr vor der September-Abstimmung war ich überzeugt, dass die LSVA nicht zu gewinnen ist. Wo ich auch aufgetreten bin, ich hatte überall das Gefühl es seien wirklich alle dagegen. Erst relativ spät - es war bei einem Podiumsgespräch der städtischen FdP in Solothurn - ist mir etwas aufgefallen, das vermutlich entscheidend war in dieser Abstimmung: Auch bei dieser Veranstaltung haben zwar sehr viele gegen die Schwerverkersabgabe gesprochen, doch bei der anschliessenden Parolenfassung haben die Frauen allesamt für die LSVA gestimmt. Spätere Abstimmungsanalysen haben bestätigt, dass die Frauen entscheidend waren, weil sie die Lastwagen offenbar etwas weniger mögen als die truckverliebten Machos.
Die beiden Verkehrsabstimmungen standen in Zusammenhang mit den bilateralen Verträgen mit der EU. Diese sind momentan wieder ein Thema.
Die Diskussionen um die bilateralen Verträge verlaufen nach dem üblichen Schema: Pro-Europäer gegen Kontra-Europäer. Dann gibt es meinetwegen eine Gruppe von rund 15 Prozent der Stimmbürgerschaft, die unentschieden ist und sich vermutlich überlegt, ob ihr durch die Verträge Nachteile erwachsen., Diesen Nachteilen versucht man nun auf parlamentarischer Ebene zu Leibe zu rücken, indem man flankierende Massnahmen festlegt - insbesondere für die Bereiche Land- und Personenverkehr. Die Kompromisse, die sich momentan im Parlament abzeichnen, lassen mich hoffen, dass die Flankierenden so ausfallen, dass sie für alle Beteiligten tragbar sind. In diesem Fall würde ich die Prognose wagen, dass man die Abstimmung zu den Bilateralen durchbringt.
Die Schweizer Demokraten haben bereits angekündigt, dass sie so oder so das Referendum gegen die «Bilateralen» ergreifen werden. Wenn man an die EWR-Abstimmung von 1992 zurückdenkt, könnte das ein harter Abstimmungskampf werden...
Dass es zur Volksabstimmung über die Verträge kommt, ist klar. Nun stellt sich die Frage, ob die Blocher-Organisationen das Referendum der Schweizer Demokraten unterstützen. Wenn das geschieht, dann ist plötzlich viel Geld vorhanden und es droht eine ganz garstige Auseinandersetzung. Ich habe Angst, das könnte die gleichen Dimensionen annehmen wie bei der Schwarzenbach-Abstimmung von 1970, welche die Zahl der Ausländer in der Schweiz reduzieren wollte.
Die bilateralen Verträge sind also für die Rechtsaussen-Parteien ein Vorwand, um eine Ausländerdebatte zu starten?
Genau. Nur ein Beispiel: Vor kurzem haben die EU-Aussenminister das Signal gesendet, die Türkei könnte eventuell in die EU aufgenommen werden. Das ist für die Europa-Gegner in der Schweiz natürlich ein gefundenes Fressen, obwohl es sachlich politisch keine Bedeutung hat. Wir haben die bilateralen Verträge nämlich mit den Staaten abgeschlossen, die sich heute in der EU befinden. Und wenn auf EU-Seite ein neuer; Staat dazukommt, dann gelten die Abkommen nicht automatisch auch für diesen Staat. In einer Volksabstimmung werden die EU-Gegner aber behaupten, da seien 60 Millionen Türken die nichts anderes in ihren Köpfen haben, als möglichst schnell in die Schweiz zu kommen und hier Arbeit zu suchen und Arbeit um jeden Preis anzunehmen. Diese Behauptung könnte obwohl falsch - hierzulande viele offene Ohren finden, vor allem weil wir trotz der wirtschaftlichen Erholungsschrittchen doch noch eine beträchtliche Zahl von Erwerbslosen haben, ins besondere auch von Ausgesteuerten.
Stichwort Arbeitslose. Die Gewerkschaften möchten die vorhandene Arbeit auf mehr Leute verteilen, indem die Arbeitszeit des Einzelnen verkürzt wird. Bei den SBB haben sie vor kurzem die 39-Stunden-Woche durchgesetzt...
Eine Verkürzung der Arbeitszeit wirft natürlich sofort die Frage auf, ob parallel dazu auch der Lohn gekürzt werden soll. Beim Experiment SBB wird der Schritt von der 41- auf die 39-Stunden-Woche folgendermassen finanziert: eine Stunde durch die Arbeitnehmer allein, indem sie auf den Teuerungsausgleich verzichten.
Stunde wird über Produktivitätsfortschritte des Unternehmens finanziert Doch Produktivitätsfortschritte bedeuten bei so einem arbeitsintensiven Dienstleistungsunternehmen wie die SBB praktisch Personalabbau, weil mit weniger Personal mehr geleistet wird. Wir haben also nicht erreicht, dass Arbeitsplätze geschaffen, sondern dass weniger abgebaut werden.
Die Wirtschaft wirds trotzdem nicht freuen, vor allem wenn das Modell SBB Schule macht.
Die Wirtschaft tobt natürlich. Ich spüre das auch in den Kontakten mit Wirtschaftsleuten. Da schlägt man mir zum Teil recht deutlich um die Ohren.- «Du bist mitverantwortlich dafür, dass man plötzlich in diesem Land über Wochenarbeitszeiten von weniger als 40 Stunden spricht.» Diesen Leuten erkläre ich dann ganz cool, wie das zustande gekommen ist und wie es finanziert wird. Denn ein Geschenk an die SBB-Angestellten ist das nicht. Aber ich kann die Massnahme als Gewerkschafter deshalb vertreten, weil dadurch 500 Stellen gerettet werden.
Das Volk ist gut beraten, mich wieder zu wählen, weil...
... ich die Sorgen und Nöte der Leute, gerade auch der kleinen Leute, kenne, und mich dennoch hüte, ich den Leuten nach dem Mund zu reden.
Eine Schweiz ohne Geheimdienst ist für mich...
... ganz einfach eine sinnvolle Sparmassnahme im Interesse der politischen Hygiene.
Um die AHV längerfristig zu sichern...
... brauchen wir schlicht etwas Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Einkommen für alle, keine Dumpinglöhne.
Einsatz von bewaffneten Schweizer Soldaten sollen in Zukunft...
... möglich werden auf freiwilliger Basis für UNO-Einsätze.
Damit die Gesundheitskosten nicht ins Unermessliche steigen, muss...
... die Anzahl der zu Lasten der Grundversicherung praktizierenden Ärzte begrenzt und müssen die Medikamentenpreise auf europäisches Niveau gesenkt werden; zudem muss ich mich bemühen, nicht zu viele medizinische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und ich muss endlich begreifen, dass bei unserer ungesunden Lebensart die Gesundheitskosten kaum sinken werden.
Wenn ich in Bundesbern etwas ändern könnte, würde ich
... die politischen Angstmacher «,("AHV geht bankrott", "Fremde verdrängen Einheimische", "der Schuldenberg erdrückt uns") für ein Jahr auf die St. Petersinsel verbannen und ihnen von Rousseau täglich einen Vortrag halten lassen über den "contrat social" und über "den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen".
< zurück zu Übersicht |