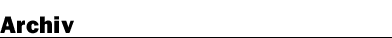
Ständerat: Sommersession 2000
Standesinitiative
Kt. ZH: Mehrwertsteuer für den öffentlichen Verkehr
Leuenberger Ernst (S, SO): Ich darf Ihnen im Namen einer kleinen,
aber entschlossenen Minderheit beantragen, der Standesinitiative Zürich
Folge zu geben. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ich mir erlaube, ganz
kurz das Verfahren bei der Behandlung von Standesinitiativen in Erinnerung
zu rufen. Sie geschieht in zwei Phasen. 1. In der Phase der Vorprüfung,
in welcher wir uns befinden, sind zwei Hauptfragen zu beantworten: Ist
etwas in der Richtung des Vorstosses in der Verwaltung oder im Parlament
im Gang? Zweitens: Ist das aufgeworfene Problem ein echtes Problem,
besteht also Handlungsbedarf? 2. In der zweiten Phase ist nach unserer
Satzung die dritte Frage - jene nach den zu ergreifenden Massnahmen,
nach dem zu beschreitenden Weg - zu diskutieren, wiewohl sich die beiden
Dinge nicht strikte trennen lassen, wie auch die Kommissionsberatung
gezeigt hat. Zur ersten Frage: Im Bericht wird festgehalten - und ich
opponiere dem nicht -, dass zurzeit weder im Parlament noch in der Verwaltung
Anstrengungen in der Richtung dieses Vorstosses im Gange sind; es ist
auch keine Volksinitiative unterwegs. Zu Recht wurde festgestellt, dass
diese Frage in den vergangenen Jahren diskutiert worden und entsprechende
Entscheide getroffen worden sind. Ich erlaube mir hier die Zwischenbemerkung,
dass vor wenigen Viertelstunden in diesem Saal dargelegt worden ist,
dass Gesetze gelegentlich nach zwei, drei Jahren bereits komplett überholt
werden müssen. Ich möchte dieser "Revisionitis" zwar nicht das Wort
reden, aber wenn neue Situationen eintreten, dann hat das zu geschehen.
Die Frage des Handlungsbedarfes bejahe ich eindeutig. Dafür führe ich
ein verkehrspolitisches Argument ins Feld: Der öffentliche Verkehr befindet
sich in härtester und zunehmender Konkurrenz; die Erhöhung der Billettpreise
im Personenverkehr anlässlich der Einführung der Mehrwertsteuer hat
Auswirkungen gezeigt, die nicht im Sinne der vom Volk und vom Parlament
getragenen Verkehrspolitik sind. Das hatte Auswirkungen auf die Kundschaft.
Die Förderung des öffentlichen Verkehrs ist ein hohes verkehrspolitisches
Ziel. Wenn heute gesagt wird, es sei ein Sündenfall, über fiskalische
Massnahmen Verkehrsförderung betreiben zu wollen, darf ich in aller
Bescheidenheit daran erinnern, dass wir seinerzeit in harten Kämpfen
in beiden Kammern des Parlamentes beschlossen haben, die damaligen Treibstoffzölle
- heute Mineralölsteuer genannt - den konzessionierten Transportunternehmungen
zurückzuerstatten. Diese Massnahme haben beide Kammern des eidgenössischen
Parlamentes gegen den erbitterten Widerstand des damaligen Finanzministers
aufrechterhalten und durchgesetzt. Es gibt sodann ein finanzpolitisches
Argument, das nicht gering zu schätzen ist und das in letzter Zeit noch
verstärkte Bedeutung gewonnen hat: Die öffentliche Hand - Bund, Kantone,
zum Teil auch die Gemeinden - fördert den öffentlichen Verkehr mit erheblichen
Mitteln. Es wirkt paradox, wenn de facto ein Teil der Subventionen,
der Unterstützungen, der Abgeltungen, die bezahlt werden, via Steuern
wieder zurückgeholt werden. Diese Situation erhält neuerdings einen
föderalistischen Finanzverteilungsaspekt. Sie erinnern sich: Am "runden
Tisch" ist vereinbart worden, dass die Bundesmittel zur Förderung des
regionalen Personenverkehrs, die ja Teil des öffentlichen Verkehrs sind,
von durchschnittlich 75 Prozent auf 68 Prozent zurückgenommen wird.
Damals hat man gesagt, dass die Kantone in die Bresche zu springen haben,
und einige Kantone haben auch feierlich erklärt, dies tun zu wollen.
Bisher gibt es keinen Grund zur Annahme, sie hätten das nicht getan.
Eine gewisse Umverteilung der Lasten ist aber festzustellen. Nun geht
diese Geschichte aber weiter, denn das Projekt des Neuen Finanzausgleichs
(NFA) nimmt diese Thematik der Bundesbeiträge an den regionalen Personenverkehr
wieder auf. Das sind derzeit immerhin rund 1,2 oder 1,3 Milliarden Franken
pro Jahr, die aus der Bundeskasse fliessen. Der NFA nimmt dieses Projekt
wieder auf und schlägt vor, die durchschnittliche Subventionierung bzw.
Abgeltung sei von 68 bis gegen 50 Prozent - mittel- bis längerfristig
sogar unter 50 Prozent - hinunterzufahren. Das heisst auch hier: Die
Kantone hätten in die Bresche zu springen. Vermutlich haben auch Sie
hier Stimmen gehört - ich habe die Stimme des solothurnischen Bau- und
Verkehrsdirektors gehört, der auf eine entsprechende Frage klar geantwortet
hat, unter diesen Bedingungen müsse er das Verkehrsangebot im Kanton
Solothurn wesentlich ausdünnen. Heute steht das ja nicht zur Diskussion.
Die Frage der Besteuerung der Fahrkarten in diesem öffentlichen Verkehr
erhält durch diesen Prozess aber eine grundlegend neue, kantonalpolitische
Bedeutung, die wir auch ins Auge fassen müssen. Wenn ich mich genau
an die Begründung erinnere, die die Vertretung des Standes Zürich für
diese Standesinitiative gegeben hat, spielte es eine wesentliche Rolle,
dass die grundsätzliche Verlagerung der finanziellen Belastung von der
Bundesebene zur Kantons- respektive Gemeindeebene durch die Besteuerung
noch verschärft wird. Ich habe mir auch erlaubt, Ihnen einen internationalen
Vergleich verteilen zu lassen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat
uns in verdankenswerter Weise eine Tabelle zur Verfügung gestellt, die
zeigt, dass doch in einigen für die Personenbeförderung - vorher wurde
der Güterverkehr herangezogen - wichtigen Ländern spezielle Sätze gelten.
Bei diesem internationalen Vergleich darf ich vielleicht auch darauf
hinweisen, dass eigenartigerweise - und offensichtlich aus Konkurrenzgründen
- die Fahrkarten im Luftverkehr der Mehrwertsteuer bekanntlich nicht
unterstehen. Obschon das in die zweite Phase gehört, muss ich doch noch
ein Wort zum zu beschreitenden Weg sagen: Der Kommissionspräsident hat
zu Recht Berechnungen dazu präsentiert, was die Übung kosten würde,
wenn man den heutigen Mehrwertsteuersatz auf diesen oder jenen Satz
reduzieren würde. Diese Berechnungen sind nicht anzuzweifeln, sondern
schlicht und einfach korrekt. Hingegen will ich erklären, dass sich
weder die entschlossene Minderheit noch der Vertreter des Kantons Zürich
im Moment der Illusion hingeben, es könnte gelingen, vom heutigen Mehrwertsteuersatz
von 7,6 Prozent .... (Zwischenruf Spoerry: 7,5 Prozent!) Gut, ich gehe
der Zeit ein bisschen voraus; Sie werden sich dann zu den 0,1 Prozent
noch äussern, und wir können dann noch darüber streiten. Ich erkläre
hier aber, dass die Minderheit folgende Idee hat: Der Mehrwertsteuersatz,
der heute beschlossen ist, könnte der Sondersatz für den öffentlichen
Verkehr werden. Etwas anderes hat kein Mitglied der Minderheit in der
Kommission geltend gemacht und, so weit ich mich erinnere, auch die
Vertreter der Standesinitiative nicht. Es ginge aber darum, im Hinblick
auf nicht auszuschliessende, künftige Erhöhungen des Mehrwertsteuersatzes
ein Zeichen zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu setzen. Wenn Sie
die Euro-Tabelle ansehen, stellen Sie mit Leichtigkeit fest, dass wir
mit 7,5 oder 7,6 Prozent gar nicht so weit entfernt sind von Sondersätzen,
wie sie in einigen wichtigen Ländern angewendet werden. Damit entfällt,
was den Sondersatz angeht, die ganze Diskussion um den Steuerausfall
auf dem heutigen Satz. Was auch immer Sie heute entscheiden: Ich vermute,
dass uns diese Frage in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird.
Ich möchte Sie daher dringend bitten, dieser Standesinitiative Zürich
Folge zu geben und damit anzuerkennen, dass im Zusammenhang mit der
Möglichkeit zur Überwälzung kommender Mehrwertsteuererhöhungen auf die
Fahrgäste ein Problem besteht. Wenn Sie diesen Handlungsbedarf bejahen,
müsste sich dann in einer zweiten Phase die Kommission zusammenraufen
und Lösungen suchen und Ihnen unterbreiten, die dann tatsächlich auch
tragfähig sind. In diesem Sinne bitte ich Sie namens der Minderheit,
der Standesinitiative Zürich Folge zu geben.
|
|
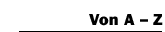 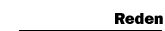  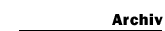 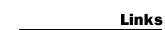 |