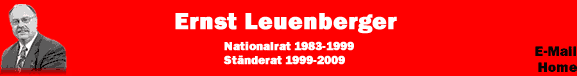|
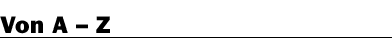
Ständerat:
04.3010 - Interpellation.
Schwerverkehrskontrollen. Ergebnisse? Weitere Massnahmen?
Eingereicht
von Leuenberger Ernst
(Wortlaut
der Interpellation)
Einreichungsdatum 01.03.2004
(Antwort
des Bundesrates)
(Behandelt
im Ständerat am 15.06.04)
Im Rahmen des Verlagerungsgesetzes führen die
Kantone seit dem 1. Januar 2001 im Auftrag des Bundes zusätzliche
Schwerverkehrskontrollen durch. Die Verstösse gegen die geltenden
Vorschriften scheinen nach Medienmeldungen ein erhebliches Ausmass aufzuweisen.
Zudem scheint auf vielen LKW-Fahrern ein erheblicher Druck seitens der
Arbeitgeber zu lasten, die Vorschriften nicht einzuhalten. Das stellt
nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko auf den Strassen dar, sondern
hat offensichtlich im Güterverkehr auch einen wettbewerbsverzerrenden
Aspekt.
1.
Welches
waren die Verstösse, welche im Rahmen der schärferen Schwerverkehrskontrollen
festgestellt wurden, und wie oft kamen diese vor?
2.
Gibt es festgestellte Unterschiede im regelverletzenden Verhalten bei
Fahrzeugen im schweizerischen respektive ausländischen Kontrollschildern?
3.
Gibt es Unterschiede in der Durchführung der Kontrollen in den
verschiedenen Kantonen?
4.
Wie gross ist der Anteil der kontrollierten Fahrzeuge in Prozent aller
Fahrzeuge im Güterverkehr?
5.
Wie gross ist die Zunahme der kontrollierten Fahrzeuge in den letzten
6 Jahren?
6.
Wie viele Ausnahmebewilligungen vom Sonntags- und Nachtfahrverbot werden
erteilt? Gibt es dabei kantonale Unterschiede? Wie überwacht der
Bund die Erteilung der Ausnahmebewilligungen?
7.
Welche Kontrollmöglichkeiten bezüglich der technischen Sicherheit
der Fahrzeuge, des Höchstladegewichts und Ruhezeitvorschriften
der Fahrer bestehen an den Landesgrenzen? Werden diese Kontrollen auch
vorgenommen?
8.
Hat sich die Strategie der "dauernden Sichtbarkeit" bewährt?
9.
Funktioniert die Absprache und Kooperation unter den Kantonen?
10.
Genügen die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel, um wirkungsvoll
kontrollieren zu können?
11.
Wie weit ist die Erstellung der geplanten Schwerverkehrskontrollzentren
fortgeschritten? Sind die Standorte festgelegt?
12.
Sieht der Bundesrat noch andere Möglichkeiten, um die Sicherheit
im Schwerverkehr zu erhöhen? Wann wird der digitale Fahrtenschreiber
eingeführt? Könnte die Erhöhung der Bussen Verstösse
verhindern helfen?
13.
Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, die Arbeitgeber und Auftraggeber
von allfällig fehlbaren Fahrern zu bestrafen, um etwas Druck von
den Fahrern wegzunehmen?
14.
Unterstützt der Bundesrat die Bestrebungen der Lastwagenfahrer
zur Schaffung eines Gesamtarbeitsvertrages im schweizerischen Strassen-Transportgewerbe?
Nach
oben
Antwort
des Bundesrates 26.05.2004
Die Verbesserung der Sicherheit im Strassengüterverkehr generell
und im alpen-querenden Güterverkehr insbesondere, ist dem Bundesrat
ein wichtiges Anliegen. Er verfolgt dieses Ziel auf nationaler und internationaler
Ebene (u.a. Verabschiedung der Charta von Verona, Teilnahme an Unterschriftszeremonie
in Dublin). Der Bund sorgt im Strassenbereich zusammen mit den Kantonen
durch intensivierte Schwerverkehrs-kontrollen für eine bessere
Einhaltung der Verkehrsvorschriften und damit für eine erhöhte
Sicherheit. Dies geschieht in einer ersten Phase durch vermehrte mobile
Schwerverkehrs-kontrollen, in einer zweiten Phase durch Kontrollen in
Kompetenzzentren. Seit 2001 hat das UVEK mit 22 bzw. seit 2002 mit 23
Kantonen Leistungsvereinbarungen über zusätzliche Schwerverkehrskontrollen
abgeschlossen.
Ad 1- 5:
Im Rahmen der intensivierten Schwerverkehrskontrollen werden folgende
Punkte überprüft:
- die Sicherheit des Fahrzeuges
- der Chauffeur, sein genereller physischer Zustand, die Fahrzeit und
die Ruhezeit
- die Verkehrsregeln (die Masse und - wenn immer möglich - die
Gewichte sowie die Einhaltung des Sonntags- und Nachtfahrverbotes)
- gefährliche Güter
- die Vorschriften über die LSVA
- Führerschein, Fahrzeugausweis und Kontrollschilder
Das Rapportwesen der Kantone war bis anhin sehr uneinheitlich. Es lässt
keine gesicherten Angaben und Schlüsse zu. Nachdem diesbezüglich
Erfahrungen gesammelt und ausgewertet wurden, schuf das Bundesamt für
Strassen im Jahr 2003 gestützt darauf standardisierte, vereinheitlichte
Tabellen. Diese gelangen nun im laufenden Jahr erstmals zur Anwendung.
Erst diese Angaben werden eine detaillierte Auswertung mit Vergleichsmöglichkeiten
der verschiedenen Angaben zulassen. Bereits heute kann jedoch - gestützt
auf die Erfahrungen der Polizeikorps - festgestellt werden, dass die
Schwerverkehrskontrollen die erwartete nachhaltige Wirkung haben und
dazu beitragen, das angestrebte Ziel, die Steigerung der Verkehrssicherheit,
zu erreichen.
Die nachfolgenden Ausführungen können nach dem Gesagten nur
als nichtrepräsentative Hinweise verstanden werden: In den Jahren
2001 bis 2003 standen Übertretungen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung
sowie gegen die zulässigen Gewichtslimiten im Vordergrund. Hinzu
kamen aufgrund der gezielten, speziellen Kontrollen zahlreiche Beanstandungen
des Fahrzeugzustandes. Die allgemeine Übertretungsquote schwankt
sehr stark. Werte über 20% waren in den Kantonen Graubünden
und Uri zu verzeichnen.
Ad 6:
Jährlich werden von den Kantonen ca. 15'000 Bewilligungen für
Sonntags- oder Nachtfahrten ausgestellt. Diese unterteilen sich in Einzelbewilligungen
für eine oder mehrere bestimmte Fahrten sowie Dauerbewilligungen
(befristet auf höchstens 12 Monate) für beliebig häufige
Fahrten. Wegen diesen drei Bewilligungsarten ist die Bezifferung der
tatsächlich durchgeführten Sonntags- oder Nachtfahrten in
absoluter Form nicht möglich.
Kantonale Unterschiede treten insoweit auf, als sich Zahl und Grösse
der im jeweiligen Kanton ansässigen Transportunternehmungen regelmässig
auch auf die Anzahl der von diesem Kanton ausgestellten Bewilligungen
auswirken.
Die Kantone müssen nach Artikel 93 Absatz 1 der Verkehrsregelnverordnung
vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) von den Einzelbewilligungen für
mehrere Fahrten und von den neu ausgestellten Dauerbewilligungen dem
Bundesamt für Strassen (ASTRA) eine Kopie zustellen. Anhand der
erhaltenen Kopien überprüft das ASTRA die kantonale Bewilligungspraxis
stichprobenweise und interveniert in jenen (wenigen) Fällen, wo
Bewilligungen nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Ad 7:
An der Landesgrenze üben die Zollämter nach Artikel 136 der
Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen
und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV;
SR 741.51) im Zusammenhang mit der Zollkontrolle von Fahrzeugen und
ihren Ladungen auch eine verkehrspolizeiliche Kontrolle aus. Die Zollämter
können die gleichen Massnahmen anordnen wie die kantonalen Polizeiorgane.
Solche Kontrollen durch das Zollpersonal werden im Rahmen der zur Verfügung
stehenden personellen Ressourcen regelmässig und stichprobenweise
vorgenommen. Bei der Kontrolltätigkeit wird darauf geachtet, dass
möglichst viel kontrolliert wird, ohne dabei den Verkehrsfluss
über die Grenze zu verlangsamen oder unnötige Staus zu produzieren.
Die Kontrollen des Schwerverkehrs beziehen sich unter anderem auf Masse,
Gewichte und Betriebssicherheit, nicht aber auf die Kontrolle der Arbeits-
und Ruhezeit und den technischen Fahrzeugzustand (z.B. Bremsen, Lenkung),
da dies zu aufwändig wäre und den Verkehrsfluss behindern
würde. Bei der Feststellung von Widerhandlungen verweigern die
Zollämter die Weiterfahrt oder bieten die Polizei auf.
Ad 8:
Die Wirkung der Kontrollen hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dabei
bestimmt die polizeiliche Vorgehenstaktik stark das Mass der festgestellten
Übertretungsquote (Verhältnis von Übertretungen zu kontrollierten
Fahrzeugen). Ein zufälliges Auswählen der zu kontrollierenden
Fahrzeuge ergibt eine tiefere Übertretungsquote als ein Auswählen
aufgrund von subjektiven Verdachtsmomenten. Das Optimum liegt hier in
einem für die Chauffeure nicht berechenbaren Mix des taktischen
Vorgehens. Dies gilt ebenso für Zeit, Ort und Umfang der Kontrollen.
Insgesamt hat deshalb ein engmaschiger und - für Chauffeure - nicht
berechenbarer Kontrollmodus eine hohe präventive und nachhaltige
Wirkung. In diesem Sinne bewährt sich die Strategie der "dauernden
Sichtbarkeit".
Ad 9:
Absprachen und Kooperation sind namentlich wichtig, um schweizweit eine
möglichst gleichwertige Kontrolle zu garantieren. Zusammen mit
einer gleichwertigen Kontrolle im Bereich der vier Alpenübergänge
wird so ein möglicher Ausweichverkehr verhindert. Diese Koordination
funktioniert gut.
Ad 10:
Im Jahr 2001 wurden für zusätzliche kantonale Polizeileistungen
10 Millionen Franken aus dem Bundesanteil der LSVA-Einnahmen zur Verfügung
gestellt, seit dem Jahr 2002 sind es jährlich 20 Millionen Franken.
Auf längere Sicht genügen die mobilen Kontrollen unterwegs
den Anforderungen an eine effiziente und effektive Kontrolle des Schwerverkehrs
nicht. Deshalb sind in der zweiten Phase Schwerverkehrskontrollzentren
mit spezialisierten Einrichtungen und Fachleuten erforderlich. Dies
hat allerdings höhere Investitions- und Betriebskosten zur Folge.
Umgekehrt können mit dem Vollausbau der Zentren die mobilen Schwerverkehrskontrollen
wieder reduziert werden.
Ad 11:
Gemäss dem Bericht "Konzept vom 1. April 2003 zur Intensivierung
der Schwerverkehrskontrollen" des Bundesamtes für Strassen
sind ein Maxi- und 12 Midi-Kontrollzentren vorgesehen. In erster Priorität
(2003 - 2007) werden das Maxi- und vier Midi-Zentren erstellt, die restlichen
in zweiter Priorität (ab 2008). Die Vorarbeiten für die ersten
fünf Zentren in Schaffhausen, Unterrealta, St. Maurice, Sigirino
und Stans oder Ripshausen sind unterschiedlich weit fortgeschritten.
Das Zentrum in Realta beispielsweise ist bereits im Bau; die Inbetriebnahme
ist auf Herbst 2004 vorgesehen. Schaffhausen dürfte den Betrieb
im nächsten Jahr aufnehmen, die übrigen Kontrollzentren folgen
in den kommenden Jahren. Bereits in Betrieb ist im Übrigen seit
Februar 2003 ein kleineres Kontrollzentrum in Stans, das ergänzend
zu den "fliegenden" Kontrollen wertvolle Dienste leistet,
zumal täglich bis zu 100 Lastwagen und Lenker kontrolliert werden
können.
Ad 12:
Im Rahmen der Entwicklung der neuen Strassen-Verkehrssicherheitspolitik
hat das ASTRA Vision, Ziele und Strategie formuliert. Zurzeit ist es
daran, verschiedene (ca. 100) Massnahmevorschläge, welche die Verkehrssicherheit
gesamthaft erhöhen sollen, gemäss verschiedenen Kriterien
zu beurteilen und zu bewerten. Darunter finden sich z.B. folgende, den
Schwerverkehr betreffende Ideen:
- Sensibilisierungs- und Informationskampagnen
- obligatorische Weiterbildung für die Führerausweiskategorien
C, C1, D, D1
- 0,0 Promille Alkohol für Berufschauffeure
- Verbot von Zweiwegkommunikation mit elektronischen Mitteln
- intensivierte Polizeikontrollen und auch sog. Abschnittskontrollen
(Trajectory Control)
- Durchsetzen des Mindestabstandes
- akustische/optische Warnbeläge und Sicherheitsmarkierungen
- Verkehrsleitsysteme auf Autobahnen
- Überholverbote für Lastwagen auf hochbelasteten Autobahnen
- Verbesserung der Beleuchtungsvorschriften / Sichtbarkeit
- umfassender Unterfahrschutz an Lastwagen
Welche Massnahmen dem Bundesrat zur Umsetzung vorgeschlagen werden,
wird im Laufe dieses Jahres entschieden.
In der EU müssen neu in Verkehr gesetzte Fahrzeuge voraussichtlich
per 5. August 2005 mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgerüstet
werden. In der Schweiz ist die Einführung des Geräts auf den
1. Januar 2006 vorgesehen.
Kein Hersteller hat den Termin vom 5. August 2003 für die Erlangung
der EG-Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät (= digitaler
Fahrtschreiber) eingehalten, welcher in der Verordnung 2135/98/EG festgelegt
ist.
Die EU Kommission hat das im gleichen Rechtsakt festgelegte Verfahren
der Mitentscheidung zwischen EU-Ministerrat und Europäischem Parlament
nicht eingeleitet, um die Einführungsfrist zu verlängern.
Anfang März 2004 hat sie dem Verkehrsministerrat ein Moratorium
vorgeschlagen, während acht bis zwölf Monaten nach dem 5.
August 2003 kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Länder einzuleiten,
die den neuen Fahrtschreiber noch nicht einführen.
Dieses Moratorium entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Der Einführungstermin
5. August 2003 besitzt auch keine Rechtsgültigkeit mehr und das
Moratorium riskiert, von den Mitgliedstaaten, Lkw-Herstellern oder Transportunternehmen
vor dem EuGH angefochten zu werden.
Es ist nicht auszuschliessen, dass eine Erhöhung der Bussen für
spezifische Übertretungen im Bereich des Schwerverkehrs eine gewisse
präventive Wirkung entfalten kann. Dabei ist zu beachten, dass
eine Anhebung nur bis zur Höchstgrenze der Ordnungsbussen von 300
Franken möglich ist (Höchstgrenze gemäss Art. 1 des Ordnungsbussengesetzes
vom 24. Juni 1970, OBG; SR 741.03). Eine Erhöhung darüber
hinaus würde bedingen, dass entweder die Höchstgrenze für
Ordnungsbussen auf gesetzlicher Ebene hinaufgesetzt wird oder gewisse
Überschreitungstatbestände nicht mehr im Ordnungsbussenverfahren
erledigt werden, sondern mit einer Anzeige an die Strafgerichte.
Im Zusammenhang mit der Einführung der 40-t-Limite im Jahr 2005
führt das Bundesamt für Strassen derzeit eine Anhörung
durch, in der auch eine Erhöhung der Strafen für Gewichtsüberschreitungen
thematisiert wird. Bisher straflose Überschreitungen bis 5% sollen
- nach Abzug der weiterhin notwendigen Geräte- und Messtoleranz
- mit einer Ordnungsbusse belegt werden, Überschreitungen zwischen
5 und 9% (bisher im Ordnungsbussenverfahren erledigt) sollen verzeigt
und damit wesentlich strenger als heute bestraft werden.
Insgesamt ist allerdings auch zu beachten, dass Bussenerhöhungen
jeweils nur eine befristete Wirkung entfalten, was anlässlich der
letzten Erhöhung der Ordnungsbussen im Jahr 1996 festgestellt werden
konnte.
Ad 13:
Strassentransportunternehmungen bedürfen einer Bewilligung zur
Ausübung ihrer Tätigkeit. Diese wird nur an Personen erteilt,
die keine schweren oder wiederholten Widerhandlungen gegen die Sozial-,
Sicherheits- sowie die Bau und Ausrüstungs-vorschriften begangen
haben. (Art. 9 und 10 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1993 über
die Personenbeförderung und die Zulassung als Strassentransportunternehmung,
Personenbeförderungsgesetz, PBG; SR 744.10). Widerhandlungen, die
durch angestellte Chauffeure begangen werden, können indes nur
selten dem Unternehmer angelastet werden, weil der Nachweis erbracht
werden muss, dass er eine Widerhandlung des Motorfahrzeugsführers
veranlasst oder nicht nach seinen Möglichkeiten verhindert hat
(Art. 100 Ziff. 2 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958,
SVG; SR 741.01). Der Hauptgrund liegt darin, dass Angestellte aus Angst
vor Verlust ihres Arbeitsplatzes vor einem Einbezug ihres Arbeitgebers
zurückschrecken. Eine über die heutigen Möglichkeiten
hinaus gehende strafrechtliche Sanktionierung von Unternehmen hat das
Parlament im Rahmen der kürzlich durchgeführten Revision des
Allgemeinen Teils des StGB zwar geprüft, aber nur für besonders
schwere Widerhandlungen im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismus
und Korruption unterstützt.
Zu prüfen wäre deshalb die Verankerung einer von der strafrechtlichen
Sanktionierung unabhängigen Administrativmassnahme im Personenbeförderungsgesetz,
wie es bereits das Luftfahrtgesetz kennt. Demnach könnten Widerhandlungen
des Fahrpersonals der Unternehmung insofern direkt zugerechnet werden,
als ihr die Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit als Transportunternehmung
befristet oder unbefristet entzogen werden könnte. Entsprechend
dem Territorialitätsprinzip könnte Inhabern einer ausländischen
Bewilligung diese allerdings nicht entzogen werden. Es müssten
deshalb Wege gefunden werden, um auch ausländischen Transportunternehmungen
administrative Sanktionen aufzuerlegen.
Ad 14:
Der Bundesrat begrüsst es grundsätzlich, wenn die Arbeitgeber
oder deren Verbände und die Arbeitnehmerverbände auf nationaler
Ebene gemeisam die Schaffung eines Gesamtarbeitsvertrages im Strassentransportgewerbe
anstreben. Darüber hinaus erachtet er es in einem zweiten Schritt
als erstrebenswert, wenn die Arbeitsbedingungen international harmonisiert
werden könnten. Diese Harmonisierung ist für die Schweiz wichtig,
weil nur so eine europäisch koordinierte Verkehrs- und Sicherheitspolitik
möglich ist. Ohne Abstimmung mit den europäischen Partnern
kommt es zu Wettbewerbs-verzerrungen, Umwegverkehr und anderen Nachteilen,
welche den Zielsetzungen der Schweizer Verkehrs- und Verlagerungspolitik
zuwiderlaufen. Der Bundesrat ist deshalb der Meinung, dass die Arbeitsbedingungen
im Transportgewerbe auf internationaler Ebene diskutiert werden sollten.
Ein geeignetes Forum dafür würde sich nach Ansicht des Bundesrates
im Rahmen der Nachfolgearbeiten zur Verkehrsministerkonferenz vom 30.
November 2001 (Suivi de Zurich) bieten.
Nach
oben
Ernst
Leuenberger (S, SO): Vielleicht ist es nicht unwichtig, dass ich
meine Motive, diese Interpellation einzureichen, hier auf den Tisch
lege.
Es gibt zunehmend Vertreter aus Kreisen des schweizerischen Strassentransportgewerbes,
die sich an mich wenden - obschon ich nicht gerade ihr erster Repräsentant
bin -, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich seitens ausländischer
Strassentransporteure einem enormen Druck ausgesetzt sehen. Sie äussern
offen die Vermutung, dass sie einer Konkurrenz seitens ausländischer
Strassentransportunternehmungen ausgesetzt seien, die sich der Mittel
des Sozial- und Sicherheitsdumpings bedient. In diesem Zusammenhang
fällt mir dann jeweils ein, dass wir seinerzeit im Zusammenhang
mit der Verlagerungspolitik in Artikel 53a Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes
geschrieben haben: "Die Kantone nehmen dem Ziel des Verkehrsverlagerungsgesetzes
vom 8. Oktober 1999 und der erhöhten Gefährdung angepasste
Schwerverkehrskontrollen auf der Strasse vor." Zu diesem Behuf,
um diese Kontrollen durchzuführen, sind den Kantonen seit dem Jahr
2001 in einem Sonderkredit zusätzliche Mittel zur Verfügung
gestellt worden.
Die Fragen 1 bis 5 zielten eigentlich darauf ab, in Erfahrung zu bringen,
was denn diese in ihrer Zahl erhöhten, verstärkten Schwerverkehrskontrollen
auf der Strasse an Resultaten ergeben hätten. Ich muss Ihnen gestehen,
dass die Antwort, positiv gesprochen, sehr summarisch ausgefallen ist;
negativ gesprochen: schlicht und einfach ungenügend! Man teilt
mir mit, das Rapportwesen der Kantone sei bisher sehr uneinheitlich
gewesen und man könne nur allgemeine Vermutungen anstellen, aber
keine handfesten Resultate produzieren. Ich finde das sehr, sehr enttäuschend.
Wenn man schon damals in den Jahren 2001 und 2002 Leistungsvereinbarungen
mit den Kantonen abgeschlossen hat, nehme ich an, dass man bei diesen
Leistungsvereinbarungen - das soll ja ein modernes Verwaltungsführungsinstrument
sein - auch tatsächlich Kontrollmechanismen eingebaut hat, die
ein ordentliches Rapportwesen auch an das Parlament, das immerhin noch
die Budgethoheit hat und das der Gesetzgeber ist, ermöglichen sollte.
Der Bundesrat antwortete am 26. Mai, er könne im Wesentlichen nicht
antworten. Ich schlage, wie wir das so zu tun pflegen, am 1. Juni eine
Zeitung auf, ein hier in Bern erscheinendes Weltblatt, und da ist eigenartigerweise
ein Bericht über das Parlament des Kantons Tessin drin, wo man
über genau die gleiche Frage debattiert hat. Offenbar hat die Tessiner
Regierung viel präzisere Angaben. Ich lese in dieser Zeitung vom
1. Juni - ich habe keine andere Quelle zur Verfügung, sintemal
die Verwaltung mir da keine Unterlagen liefern können will - zu
meiner Grundfrage bezüglich der ausländischen Dumping-Konkurrenz:
Auf Tessiner Boden werde der grösste Teil der Verfehlungen dieser
Art - nämlich Übertretungen von Lastwagenfahrern - von Chauffeuren
ausländischer Firmen begangen, schreibe die Tessiner Regierung.
Das möchte ich verifizieren respektive falsifizieren. Es wird dann
weiter erwähnt, es seien elektronische Zusatzgeräte installiert
worden, die den Fahrtenschreiber beeinflussen, damit die am Steuer verbrachte
Zeit und die Geschwindigkeit falsch aufgezeichnet würden. Dieser
Praxis könne man praktisch nicht Herr werden, wenn man nicht sehr
aufwendige Kontrollen vornehme. Die Tessiner Regierung antwortet dann
auch auf die Frage zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge, eine Frage,
die mich gesamtschweizerisch sehr interessiert. Es wird nämlich
gesagt, von den 1,6 Millionen Fahrzeugen, die den Kanton im Jahr 2003
durchquert hätten, seien 10 849 kontrolliert worden. Das sind etwa
0,6 Prozent, eine Quote, die in dieser Tessiner Debatte als unbefriedigend
erachtet worden ist.
Für mich heisst das im Klartext, dass ich grosse Hoffnungen darauf
setze - um dem Ganzen eine positive Wende zu geben -, dass inskünftig
die Verwaltung von den Kantonen präzisere Berichte erhält
und der Bundesrat dann in der Lage sein wird, auf die Interpellation,
die ich etwa in zwei Jahren wieder einreichen werde, diese Fragen präzise
zu beantworten. Sollte es sich erweisen, dass mein Grundverdacht richtig
ist, der von schweizerischen Strassentransportunternehmen geäussert
worden ist, es gebe so etwas wie ausländische Sozial- und Sicherheitsdumping-Konkurrenz,
könnten wir dann gemeinsam überlegen, mit welchen Methoden
da Abhilfe geschaffen werden kann.
Ein Detail aus der bundesrätlichen Antwort muss ich gleichwohl
noch aufgreifen und nachfragen:
Zur Antwort auf Frage 7: Man legt mir hier dar, was man an der Grenze
kontrollieren kann und was man an der Grenze nicht kontrollieren kann.
"Die Kontrollen des Schwerverkehrs beziehen sich u. a. auf Masse,
Gewichte und Betriebssicherheit" - und jetzt kommt's! -, "nicht
aber auf die Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeit und den technischen
Fahrzeugzustand (z. B. Bremsen, Lenkung), da dies zu aufwendig wäre
und den Verkehrsfluss behindern würde." Da muss ich Ihnen
offen gestehen, da würde ich den Bundesrat einladen, diese Praxis
zu ändern. Es ist sehr wohl sinnvoll, an der Grenze, wo man die
Fahrzeuge stehen hat und sich mit den Fahrern auseinander setzen muss,
just auch die Arbeits- und Ruhezeit zu kontrollieren und übermüdete
Lastwagenfahrer gar nicht in die Schweiz einfahren zu lassen. Das scheint
mir eigentlich nahe liegend zu sein. Und den technischen Fahrzeugzustand
- das hat mit dem Vorwurf des Sicherheitsdumping zu tun - dürfte
man durchaus auch an der Grenze kontrollieren. Da habe ich Mühe
mit der bundesrätlichen Antwort und möchte den Bundesrat einladen,
diese Praxis zu ändern.
Ich will nicht gerade sagen, wir sehen uns bei Philippi wieder, aber
Sie werden Verständnis haben, Herr Bundesrat, dass etwa in zwei
Jahren ich meine Fragen noch einmal stellen muss, weil diese Zahlen,
die die Kantone Ihnen dann geliefert haben werden, uns in diesem Lande
brennend interessieren, nicht nur unter dem Aspekt der Verlagerungspolitik,
sondern auch unter dem Aspekt der Verteidigung schweizerischer Arbeitsplätze
im Strassentransportgewerbe.
Nach
oben
Leuenberger
Moritz, Bundesrat: Das Anliegen ist ja mehr als berechtigt, und
wir verfolgen es eigentlich auf zwei Gleisen: einerseits auf der internationalen
Ebene und andererseits im Verhältnis intern mit den Kantonen.
Auf internationaler Ebene ist es deswegen sehr wichtig, damit endlich
Harmonisierungen bezüglich Ruhezeiten, aber auch bezüglich
Lohn, bezüglich Fahrzeiten, auch bezüglich Ausstattung der
Fahrzeuge usw. umgesetzt werden. Dazu haben in letzter Zeit Zusammenkünfte
mit den europäischen Verkehrsministern in Verona und in Dublin,
aber auch in Zürich stattgefunden. - Sie wissen vielleicht, dass
die Schweiz nach dem Unfall im Gotthardtunnel die Initiative ergriffen
hat, die Sicherheit auf den Strassen in Bezug auf die Lastwagen zu optimieren.
Sämtliche eingeladenen Verkehrsminister sowie auch die Vertreter
der Europäischen Kommission sind bei diesen Zusammenkünften
erschienen, und hier sind wir tatsächlich daran, internationale
Harmonisierungen durchsetzen zu können. Das ist nicht ganz leicht,
wenn man es "von ausserhalb der EU" machen muss. Zwar sind
wir mitten in Europa - der Transit geht durch unser Land -, aber wir
sind nicht Mitglied der Europäischen Union und sind also nicht
etwa regelmässig an den Konferenzen der europäischen Verkehrsminister
zugegen. Das dann also gewissermassen von aussen aufbrechen zu müssen,
ist relativ schwierig. Aber wir arbeiten hier sehr intensiv.
Das andere ist die Umsetzung im Innern des Landes. Da haben Sie die
Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen genannt. Leistungsvereinbarungen
heissen sie, weil wir den Kantonen das notwendige Geld geben. Sie haben
Recht: Dazu müssen wir dann natürlich auch die notwendigen
Zahlen, Ergebnisse und Garantien in Bezug auf das haben, was die Kantone
machen. Beachten Sie aber auch, dass das Ganze im Aufbau ist. So ein
Kontrollzentrum ist eine riesige Geschichte: Das ist nicht wie eine
flottante Polizeikontrolle, die auf einer Nebenstrasse schaut, ob die
Pneus genügend Profil haben, sondern da braucht es sehr komplizierte
Wagen, Doppelwagen zum Teil, hoch technische Sachen, und es braucht
Ausfahrten, damit der Verkehrsfluss auf der Autobahn nicht behindert
wird. Diese Anlagen werden von den Kantonen gebaut. Zum grossen Teil
stehen sie noch nicht, aber auch dieses Jahr wird in Realta wieder eine
eingeweiht. Es wird eine Maxi-Anlage eingeweiht, und auch einige kleinere
Anlagen werden eingeweiht. Das Ganze ist also im Aufbau begriffen, und
Sie haben das Recht, hier schon viel früher als erst in zwei Jahren
wieder nachzufragen. Es ist richtig, dass das Rapportwesen der Kantone
wahrscheinlich verbesserungswürdig ist.
Was die Kontrolle an der Grenze selber angeht, so sind es dann eben
nicht die Polizeikorps, die diese machen, sondern die Zöllner.
Schon für die wenigen Kontrollen, die sie - neben ihrer eigentlichen
Aufgabe, nämlich der Warenkontrolle - jetzt machen, mussten sie
umgeschult werden. Wenn sie jetzt also auch noch die Ruhezeiten, die
Tachoscheiben und was weiss ich alles kontrollieren müssen, braucht
es weitere Umschulungen. Im Prinzip haben Sie natürlich Recht:
Wenn ein Fahrzeug an der Grenze schon stillstehen muss, dann könnte
man den Halt auch gleich noch für diese Kontrollen benützen.
Aber auch da kommen technische Einwände. Steter Tropfen höhlt
den Stein - ich bin froh, dass Sie das heute wieder gesagt haben.
Nach
oben
|
|
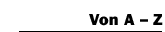 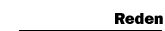  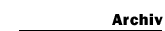 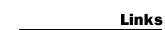 |